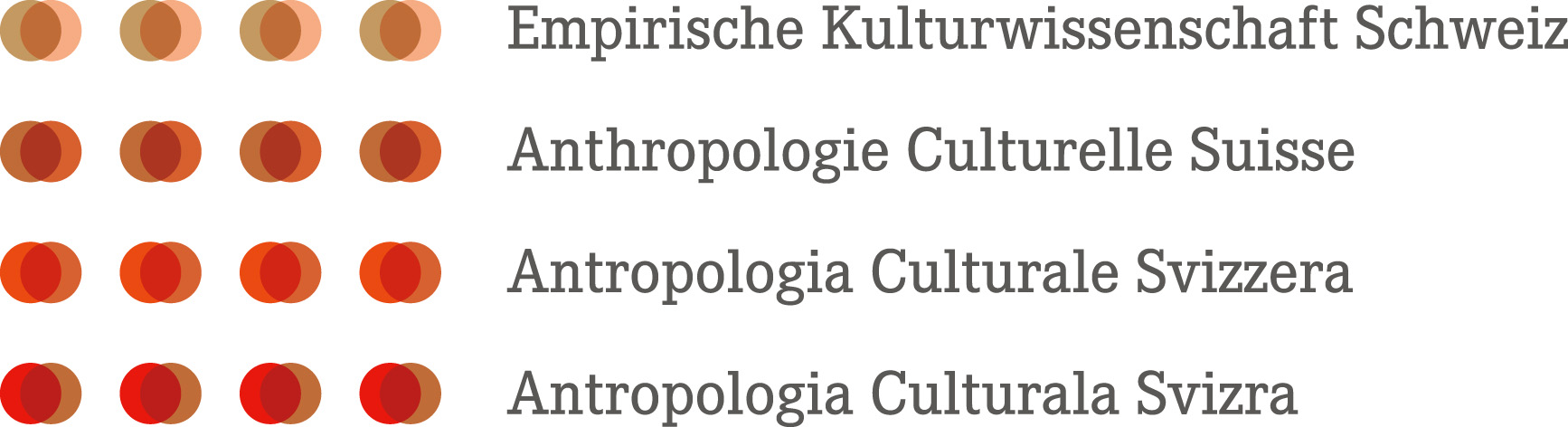Das Jubiläumsmagazin von 2021

2021 hat die EKWS – damals noch unter dem Namen SGV (Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde) – ihren 125. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass haben wir ein Jubiläumsmagazin herausgegeben, das unsere Mitglieder ins Zentrum stellt. Dreissig Personen wurden dafür ausgewählt, welche die breiten Themen der EKWS repräsentieren. Sie alle haben einen Text verfasst, der Einblick in ihre Alltagswelt gibt und der ihre Verbindung zur EKWS aufzeigt. Porträtiert wurden die Mitglieder vom renommierten Schweizer Fotografen Andri Pol. Er ist den Autorinnen und Autoren in alle Landesteile gefolgt und hat einzigartige Porträts gemacht.
Die Porträts aus dem Magazin stellen wir Ihnen hier vor.
Wir wünschen viel Spass beim Entdecken!
Edwin Huwyler – Aus den Alpen in den Hindukusch und wieder zurück

Porträtbild © Andri Pol
Wahrscheinlich verdanke ich der SGV, das heisst der Schweizerischen Bauernhausforschung mein Leben, aber davon später. Aufgewachsen im kleinen Bergdorf Melchtal, kam ich als fleissiger Schüler und frommer Ministrant durch die Vermittlung des Pfarrers in eine Klosterschule, natürlich mit der Hoffnung, aus mir einen Theologen zu formen. Acht Jahre in Mönchskutte, trimesterweise eingesperrt, waren diesen Plänen nicht besonders förderlich. Kurt Gloors Film «Die Landschaftsgärtner» hat mich auf die Idee gebracht, bei «Schweizer Jugend forscht» eine Arbeit einzureichen und in der Folge dann auch Volkskunde zu studieren – wäre da nicht Afghanistan dazwischengekommen.
Nach der Matura, also im Jahr 1972, sind wir zu zweit in einem alten Triumph Spitfire Richtung Asien gefahren. Das Land am Hindukusch hat mich so fasziniert, dass ich mich für Ethnologie als Hauptfach entschloss. Es folgten sechs Reisen nach Afghanistan mit meiner Lebens- und Forschungspartnerin Iren von Moos. Als der Krieg ausbrach, konnten wir unser Gebiet nur noch illegal über Pakistan erreichen. Während unseres letzten Aufenthalts wurden wir für kurze Zeit als Geiseln festgehalten, und Fundamentalisten drangen bis in «unser» Bergdorf vor. Zurück in Obwalden ergab sich die Gelegenheit, den Band Ob- und Nidwalden in der Reihe «Die Bauernhäuser der Schweiz» in Angriff zu nehmen. Meine Partnerin musste ihren Entschluss, weiterhin über Afghanistan zu arbeiten mit dem Leben bezahlen. Am 5. August 1988 wurde sie in Pakistan umgebracht. Erst nachträglich habe ich erfahren, dass wir wegen unserer kritischen Berichterstattung auf einer Roten Liste der Taliban standen.
Der Wechsel in die Bauernhausforschung war für mich in vielerlei Hinsicht ein Glücksfall. Es hat zwar viel Überwindung gekostet, zum Inventarisieren an fremde Türen zu klopfen und bis in die Intimsphäre der Bewohner/innen vorzudringen, aber was blieb, war eine grosse Befriedigung, am Leben und an der Gedankenwelt dieser Menschen teilhaben zu können. Da sich die architektonischen Varianten in einer vom Blockbau geprägten Hauslandschaft in Grenzen hielten, konnte ich mich ganz auf die Wohnkultur konzentrieren. Was sagt mehr über die Mentalität des Menschen aus als die Gestaltung ihrer Wohnsphäre? Allerdings hat mich die Arbeit am Bauernhausband ehrlich gesagt an die Grenzen meiner Kräfte gebracht. Für einen eher chaotischen Menschen war es eine immense Herausforderung, das umfangreiche Material aus der Feldforschung, aus der Literatur und aus den Archiven in den vorgegebenen Raster der Bauernhausreihe zu verarbeiten. Besonders viel Kraft hat mich damals auch mein Mandat als Kantonsrat gekostet. Als erste «Linke» (damals gab es in Obwalden nicht einmal eine SP) stiessen wir im Parlament auf viel Misstrauen, und wir mussten die Geschäfte besonders intensiv vorbereiten. In dieser schwierigen Zeit habe ich das Angebot vom Freilichtmuseum Ballenberg, dort als Vizedirektor zu arbeiten, abgelehnt, da ich schon mündlich zugesagt hatte, das Heimatmuseum in Sarnen zu übernehmen.
Die letzten 21 Jahre meines Berufslebens habe ich trotzdem auf dem Ballenberg verbracht. Über meine Forschung in Obwalden sind mir Mängel an den Obwaldner Gebäuden im Freilichtmuseum aufgefallen, die ich schriftlich an die entsprechenden Gremien weitergeleitet habe. In der Folge hat man nicht nur die Fehler behoben, ich wurde sogleich in die Fachgruppe Wissenschaft aufgenommen. Daraus ergab sich die Anfrage für die wissenschaftliche Leitung, die ich nach erstem Zögern schliesslich annahm. Dass ich vorher kaum Museums- und Führungserfahrung hatte, habe ich mir ehrlich gesagt gar nie überlegt. Obwohl der Wechsel vom Forscher und Schreiber im entlegenen Bauernhaus hoch über Sarnen in ein Museum mit 200 Mitarbeiter/innen auf der Lohnliste und einem Millionenbudget heftig war, habe ich ihn nie bereut.
Das Studium der Volkskunde habe ich übrigens noch nachgeholt. Um meine Dissertation über die schweizerische Hausforschung bei Frau Prof. Burckhardt-Seebass (an der Universität Basel) einzureichen, musste ich vier Semester Volkskunde nachholen, nicht einfach neben einem 90-Prozent-Pensum auf dem Ballenberg, aber sehr bereichernd. Volkskunde belegte ich früher nur im Nebenfach. Damals haben mich insbesondere die Vorlesungen von Dr. Max Gschwend über die Bauernhausforschung und jene von Prof. Paul Hugger über das Filmarchiv der SGV fasziniert. Die Filme und Fotos aus dem SGV-Archiv waren dann auch wertvolle Ergänzungen zur Arbeit auf dem Ballenberg und speziell auch für das dazugehörige Kurszentrum. Die Filme «’Aufrichte’ in Heimiswil» oder «Heimposamenterei», um nur zwei Beispiel zu nennen, sowie die Fotoserien von Ernst Brunner sagen mehr als tausend Worte und waren für die Arbeit auf dem Ballenberg äusserst wertvoll. Und was mich besonders freut, ist die Übernahme des Archivs für Bauernhausforschung ins Freilichtmuseum. Die verschiedenen Archive der SGV sind ein unschätzbarer Fundus an vielfältigen Zeugnissen einer ländlich-bäuerlichen Welt, die innert kürzester fast völlig verschwunden ist und die ich in den 1950er-Jahren kurz vor der Mechanisierung der Landwirtschaft im Berggebiet von Melchtal noch selber miterlebt habe.
Elisa Frank / Nikolaus Heinzer: Der Wolf – ein Kulturthema, das die Schweiz bewegt

Porträtbild © Andri Pol
Im Rahmen eines Forschungsprojektes des Schweizerischen Nationalfonds haben wir uns während mehrerer Jahre mit Wölfen befasst. Moment: Wölfe? Dazu forschen doch Biolog*innen? Ja, aber nicht nur: Die Rückkehr der Wölfe in die Schweiz seit Mitte der 1990er-Jahre ist auch ein Kulturthema, denn sie ist ein Vorgang, mit dem wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen. Wölfe sind geschützte Wildtiere, reissen bisweilen jedoch Nutztiere und stellen die Landwirtschaft gerade in den Alpen vor Probleme. Doch nicht nur deshalb bewegen sie viele Menschen und generieren intensive Debatten: Identität und Tradition, Selbstbestimmung und Fremdbestimmung, Sicherheit und Artenvielfalt, die Beziehung von peripheren Regionen und urbanen Machtzentren, von lokaler Bevölkerung und staatlichen Behörden sowie die Frage nach einem zeitgemässen Umgang mit Natur – im Windschatten der Wölfe verhandeln Gesellschaften Fragen von weit grösserer Reichweite, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Rückkehr dieser Tiere ist daher nicht nur ein ökologischer, sondern ebenso ein kultureller und sozialer Prozess, der über einen blossen Interessenkonflikt zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz hinausgeht und die Lebens-, Arbeits- und Vorstellungswelten vieler Menschen betrifft, deren Positionen kaum auf ein simples Pro- und Kontra-Schema reduziert werden können.
Unsere kulturwissenschaftliche Perspektive auf die Rückkehr der Wölfe konnten wir im Verlauf der Jahre auch einer breiteren interessierten Öffentlichkeit vermitteln: in Vorträgen, in kurzen Texten für Magazine und Blogs, als Expert*innen in Beiträgen in den Medien oder im Rahmen einer Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Alpinen Museum der Schweiz. Dabei ging es uns nicht darum, praxisorientierte Lösungen für die vielschichtigen Probleme aufzuzeigen, die im Zusammenhang mit der erneuten Präsenz von Wölfen in der Schweiz auftreten; dies war nicht der Fokus unseres als Grundlagenforschung angelegten Projektes. Vielmehr wollten wir sensibilisieren und differenzieren: Wir wollten am Beispiel der Wölfe deutlich machen, wie vielfach verwoben Natur und Gesellschaft in der Schweiz heute sind; wir wollten Muster im gesellschaftlichen Umgang mit den grossen Beutegreifern aufzeigen, die sich quer durch alle Positionen ziehen, und wir wollten schliesslich den Blick auf die Vielfalt von Erfahrungen und Stimmen lenken – einen Blick, der neue Perspektiven jenseits vom Schema guter Wolf vs. böser Wolf eröffnet und damit auch einen konstruktiven Beitrag an die gesellschaftliche Debatte leisten soll.
Dabei waren wir immer angewiesen auf Partner*innen, die uns Plattformen boten, auf denen wir uns an eine breitere Öffentlichkeit wenden konnten. Dazu gehörten in zwei Fällen auch Organe der SGV: Nach einem Jahr Forschung hielten wir einen öffentlichen Vortrag bei der SGV Sektion Basel; und Nikolaus Heinzer konnte im «Wallis»-Heft der «Schweizer Volkskunde» (dem ehemaligen Korrespondenzblatt der SGV) einen kurzen Text über seine Feldforschung bei einem Wildhüter im Lötschental veröffentlichen, in dem er aufzeigte, wie die Präsenz eines Wolfes in einem lokalen Kontext verhandelt wird. Solche Gelegenheiten waren für uns auch deswegen wertvoll, weil sie es uns ermöglichten, etwas in unser Feld zurückzuspielen: Zu öffentlichen Vorträgen konnten wir Personen, die wir interviewt oder die wir teilnehmend-beobachtend begleitet hatten, einladen, wir konnten ihnen Texte, die wir für ein breites Publikum verfasst hatten, zukommen lassen, oder sie konnten die von uns mitverantwortete Ausstellung besuchen. Das gab Menschen aus unserem Forschungsfeld die Möglichkeit, zu sehen, was genau wir mit dem, was sie uns sagen und zeigen, machen, wie wir diese Daten interpretieren und analysieren. Nicht zuletzt hat uns dies auch den einen oder anderen neuen Kontakt eröffnet.
In einer solchen Kommunikation all der spannenden und relevanten Forschungsprojekte, die an den empirisch-kulturwissenschaftlichen Instituten der Schweiz angesiedelt sind, sehen wir denn auch eine Aufgabe, die die SGV in Zukunft noch verstärkt angehen könnte. So könnten beispielsweise Forschende (insbesondere auch Nachwuchs-Forschende) über verschiedene Kanäle einer breiten Öffentlichkeit präsentiert und bei Medien, Verbänden, Organisationen, Verwaltung, Politik oder Museen als Expert*innen bekannt gemacht werden, die man befragen, die man einladen, mit denen man sich austauschen oder mit denen man zusammenarbeiten kann. Als Verein, dem sowohl Lai*innen wie Wissenschaftler*innen angehören, kann die SGV für den Dialog zwischen Forschung und Öffentlichkeit auf vielfältige Erfahrungen zurückgreifen und verfügt daher über die besten Voraussetzungen für die Rolle als Wissenschaftsvermittlerin. Genau in diesem Bereich sind wir denn auch beide für die SGV tätig: Nikolaus organisiert als Vorstandsmitglied der SGV Sektion Zürich Veranstaltungen und Vorträge, Elisa gehörte viele Jahre zum Redaktionsteam des Bulletins «Schweizer Volkskunde» und ist seit 2021 im Vorstand der SGV. Zu diesem Engagement motivieren uns gerade auch unsere eigenen Erfahrungen: Als junge*r Wissenschaftler*in zu realisieren, dass das Thema, mit dem man sich auseinandersetzt, von gesellschaftlicher Relevanz ist, und die Möglichkeit zu erhalten, die eigene Forschung einer interessierten Öffentlichkeit vorzustellen, ist eine grosse Motivation für die eigene wissenschaftliche Tätigkeit.
Elisa Frank (*1989) hat Kulturanthropologie und Geschichte in Basel und Grenoble studiert. Von 2016–2020 war sie zusammen mit Nikolaus Heinzer Doktorandin im SNF-Projekt «Wölfe: Wissen und Praxis» am ISEK (Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich), das die Rückkehr der Wölfe in die Schweiz als kulturellen und sozialen Prozess untersucht. Während ihrer Doktorarbeit hat sie 13 Notizbücher mit Feldnotizen und Gedanken gefüllt – ein wichtiges Arbeitsinstrument. Aktuell arbeitet sie an einem populärwissenschaftlichen Buch über die Wölfe in der Schweiz als Kulturthema mit, das 2022 erscheint. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in den Bergen oder mit Handarbeiten. Elisa Frank ist ausserdem seit 2021 Vorstandsmitglied der SGV.
Nikolaus Heinzer (*1987) hat Ethnologie, Spanische Literaturwissenschaft und Politologie in Zürich studiert und einen Master in Ethnologie in München absolviert. Er war von 2016–2020 zusammen mit Elisa Frank Doktorand am ISEK (Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich) im Rahmen des SNF-Projekts «Wölfe: Wissen und Praxis». Seit 2021 ist er mit der Entwicklung eines Postdoc-Projekts zum Thema Nachhaltigkeit und Gewässer beschäftigt und arbeitet an einem populärwissenschaftlichen Buch über die Wölfe in der Schweiz als Kulturthema mit, das 2022 erscheint. In seiner Freizeit unternimmt er gerne Reisen, macht und hört viel Musik und spielt Fussball. Er ist seit 2018 im Vorstand der SGV Sektion Zürich tätig.
Uolf Candrian – Ein verschollenes Theaterstück entdeckt

Uolf Candrian (*1992) in der Surselva geboren, hat in Zürich Populäre Kulturen, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften und Rätoromanische Literaturwissenschaft studiert und einen Master in Kulturanalyse absolviert. Nach einem einjährigen Praktikum bei der Kulturvermittlung Schweiz ist er derzeit Doktorand der Universität Basel im SNF-Forschungsprojekt «Mensch und Haus» im Freilichtmuseum Ballenberg, in welchem er die historischen Wirtschaften im Freilichtmuseum Ballenberg erforscht. Er fährt gerne Ski, engagiert sich im Jugendverein und liest Gedichte in fast allen romanischen Sprachen.
Porträtbild © Andri Pol
Hundert Jahre hatte das rätoromanische Manuskript bereits in einer Kommode auf dem Dachboden seines Elternhauses in Sagogn gelegen, als es der heute pensionierte Lehrer Peter Candrian (*1941) endlich im Jahr 2015 entdeckte. Es war das Manuskript eines Theaterstücks mit dem Titel «Ilg Plan faleu» (Der misslungene Plan), geschrieben von unbekannter Hand. Peter Candrian wurde neugierig und kontaktierte mich, weil ich in Zürich Kulturanalyse studierte. Weder Peter noch ich erwarteten, dass das Stück literarisch wertvoll sein könnte, aber ich begab mich dennoch auf die Spurensuche und versuchte, den Autor ausfindig zu machen. Oder sollte es sich etwa um eine Autorin handeln?
Alle 14 bisher bekannten rätoromanischen Autorinnen, die im 19. Jahrhundert lebten, stammten aus dem Engadin, waren nach 1850 geboren und hatten ihre Texte erst nach 1900 veröffentlicht. Die erste schreibende Rätoromanin war Mengia Vielanda-Bisaz (1713–1781). Danach finden sich keine Hinweise auf Autorinnen mehr, bis Lina Liun (1875–1943) und Annetta Klainguti-Ganzoni (1875–1936) gemeinsam begannen, Dramen zu schreiben. In der Surselva sollen schreibende Frauen zuerst als Übersetzerinnen in Erscheinung getreten sein, so etwa die Lehrerin Mariuschla Cavelti (1860–1896) aus Sagogn.
Wer aber war die Person, die das Theaterstück «Ilg Plan faleu» verfasst hatte? Einen ersten Hinweis auf die Urheberschaft lieferte die protestantische Orthografie, da die reformierte Varietät des rätoromanischen Dialekts mit einem eindeutigen Lokalkolorit von Sagogn benutzt wurde. So kann als sicher angenommen werden, dass der Autor oder die Autorin aus Sagogn stammte. Einen zweiten Hinweis liefert eine von dieser Person erzählte Sage. Diese findet sich in der «Mythologischen Landeskunde», einer Sammlung von Volkserzählungen aus dem Kanton Graubünden, die Arnold Büchli (1885–1970) herausgegeben hatte. Zu dieser Geschichte kam Büchli über den Pfarrer Emil Camenisch (1874–1958), der ihm die Sage «Ilg Chisti da Sagoing» (Die Burg von Sagogn) zusammen mit einer Porträtaufnahme der bereits verstorbenen Erzählerin überreichte – es war das Porträt von Barla Coray-Padrun (1840–1922), einer verwitweten Bäuerin, deren Ehe mit Peder Coray (1826–1908) wohl kinderlos blieb. Pfarrer Camenisch war es übrigens auch, der 1922 auf dem Friedhof von Sagogn ihre Grabrede hielt. Die handgeschriebenen Notizen zu dieser Grabrede befinden sich im Nachlass des Pfarrers im Staatsarchiv Graubünden. Ich fand jedoch niemanden, der in der Lage war, die Handschrift des Pfarrers zu entziffern. Dagegen befinden sich im Staatsarchiv die Zeitungen, in denen Barla Coray-Padrun bis zu ihrem Tod Feuilleton-Übersetzungen veröffentlichte. Sie hat Geschichten übersetzt, in denen die Frauen, wie im gefundenen Theaterstück, eine Hauptrolle spielen. Damit scheint mir so gut wie sicher, dass es sich bei der Urheberschaft von «Ilg Plan faleu» um Barla Coray-Padrun handeln muss.
Das Theaterstück «Ilg Plan faleu» beschäftigt sich mit der Liebesheirat und der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Neben diesem Kernthema interessierte mich auch der Stellenwert der rätoromanischen Theaterkultur im Dorf Sagogn. Theateraufführungen waren hier stets Unterhaltungs- und Bildungsprogramm in einem. Sie waren sowohl für die Gesellschaft als auch für den Erhalt der Sprachgemeinschaft von grosser Bedeutung, da Sprechübungen bei Proben für die Schauspielenden dazugehörten. In Barla Coray-Padruns Stück findet sich unter anderem dieser bemerkenswerte Satz: «Schei tier ad ellas quei ca sauda e vus hummens vegnits alur buc manai davos la cazolla, ne da gi ne da notg» – «Lasst ihnen das, was ihnen zusteht, und ihr Männer werdet dann nicht hinters Licht geführt, weder bei Tag noch bei Nacht». Diese Aussage zeigt exemplarisch, wie Themen wie die Ehe um 1900 ausgehandelt wurden und wie Barla Coray-Padrun sich für mehr Selbständigkeit der Frauen einsetzte. Aufgeführt wurde das Stück bisher allerdings nie – war es vielleicht zu gesellschaftskritisch? Aber die Hoffnung besteht, dass «Ilg Plan faleu» doch noch auf die Bühne kommen könnte, 125 oder mehr Jahre, nachdem es verfasst worden war. Denn Sagogn hat bis heute eine vitale und engagierte Theaterkultur bewahrt.
Denise Tonella – Liebe auf den zweiten Blick

Denise Tonella (*1979) ist in Airolo geboren. Ihre berufliche Laufbahn begann 1998 mit dem Studium der Geschichte und Kulturwissenschaft an der Universität Basel, wo sie unter anderem das Thema Film für sich entdeckte. Ab 2005 vervollständigte sie ihre Ausbildung mit zahlreichen Filmkursen in Göttingen, München, London und Zürich. Nach einer längeren Asienreise und der Mitwirkung bei einer Filmproduktionsfirma, die sie mitbegründet hat, kam sie 2010 als wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Schweizerischen Nationalmuseum. Seit 2014 war sie dort als Kuratorin und Projektleiterin tätig und seit Frühling 2021 ist sie als Direktorin des Nationalmuseums im Amt. Ihre Freizeit verbringt sie gerne auf dem Maiensäss im Tessin, beim Fotografieren oder auf Reisen.
Porträtbild © Andri Pol
«Volkskunde», was könnte dies für ein Fach sein? – fragte ich mich vor gut 20 Jahren, als ich an der Universität Basel gerade Islamwissenschaften als Nebenfach ausgeschlossen hatte. Ein Blick in das Vorlesungsverzeichnis hatte meine Neugier geweckt. Neben Brauchforschung schien es auch um Warenhäuser als Schauplatz von Leben und Kultur, um europäische Subkulturen, um unsere Beziehungen zu den Dingen oder um unsere Ernährung zu gehen – kurz: um Erscheinungen der menschlichen Alltags- und Populärkultur.
Ich zögerte aber trotzdem noch. Irgendwie war mir die Bezeichnung des Fachs suspekt. In meinem Kopf klangen «Volk» und «Kunde» irgendwie … alt. Und die wortwörtliche Übersetzung davon ins Italienische half ebenfalls nicht: «Lo studio del popolo?» oder eher «La scienza del popolo?». Ich entschied mich trotzdem, ein Seminar zu besuchen. Es waren nur wenige Studierende da, das Fach schien nicht gross zu interessieren. War es eine schlechte Entscheidung gewesen? Zu Beginn hatte ich also durchaus meine Zweifel. Ich wusste zu jenem Zeitpunkt noch nicht, dass die Volkskunde mein Studium und meine berufliche Laufbahn positiv und nachhaltig prägen würde. Zum Glück ist man manchmal neugierig genug, um auch Dinge auszuprobieren, von denen man noch nicht weiss, was sie einem bringen.
Was ich dabei entdeckt und erlebt habe, war grossartig und zutiefst bereichernd. Bald war ich auf Exkursion in Polen, spazierte zum Königsschloss auf dem Wawelhügel, schlenderte durch den ehemaligen jüdischen Stadtteil Krakaus, besichtigte einen ethnografischen Park in Nowy Sacz und sass ergriffen in Auschwitz und Birkenau, wo ich zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart fast das Gleichgewicht verlor: Der Ort, an dem früher die KZ-Baracken standen, sah inzwischen schon fast wieder idyllisch aus. Es duftete nach frisch gemähtem Gras und Sommerblumen.
Ein paar Semester später machte ich ein Kurzpraktikum im Museum Appenzell und wanderte zum ersten Mal zum Säntis. Handstickerei, Trachten, Volksglaube und Handwerk waren hier die Themen. Es war interessant, aber ich dachte mir: Das Museum ist nicht so wirklich mein Ding. Wenn mir jemand damals gesagt hätte, dass ich eines Tages leidenschaftlich Ausstellungen kuratieren und sogar ein Museum leiten würde, hätte ich wohl nur verblüfft geschaut.
Und dann, ein paar weitere Semester später, machte es klick: Im Rahmen einer Vortragsreihe der SGV hörte ich den Filmemacher und Leiter der Abteilung Film der SGV, Hans-Ulrich Schlumpf, über seine Filme reden. Dabei entdeckte ich, dass Feldforschung auch heissen konnte, mit der Kamera ins «Feld» zu ziehen, Leute durch den Sucher zu beobachten und zu interviewen. Ich fand das ein unglaublich faszinierendes und kluges Werkzeug, um Geschichten einzufangen und sie für ein breites Publikum erfahrbar zu machen. Ich verschlang Bücher von Edmund Ballhaus, Beate Engelbrecht, David MacDougall, Karl G. Heider oder Steven Feld über den ethnographischen Film und besuchte, sobald es die Gelegenheit gab, ein Seminar bei Hans-Ulrich Schlumpf. Er zeigte uns Filme wie «Guber – Arbeit im Stein» über einen Steinbruch im Kanton Obwalden. Die Kamera folgte dem Leben der portugiesischen Saisonniers in einem ihnen fremden Land, porträtierte das Handwerk und die vielfältigen Beziehungen zwischen Natur und Mensch. Mir war klar: Ich wollte mir dieses vielseitige Werkzeug aneignen!
Gegen Ende des Studiums wusste ich nicht mehr, was mir besser gefiel: Mein Hauptfach Geschichte oder mein erstes Nebenfach Volkskunde, das inzwischen den Namen in Kulturwissenschaft/Europäische Ethnologie geändert hatte, womit ich viel besser umgehen konnte. Denn das liess sich gut ins Italienische übersetzen und kam der italienischen Bezeichnung für das Fach – Antropologia culturale – viel näher. Ich entschied, ein paar Prüfungen mehr zu machen und beide Fächer als Hauptfach anerkennen zu lassen. Die Lizentiatsarbeit schrieb ich über ein Thema, das beide Fächer abdeckte: Die gegenwärtige Wahrnehmung des Mittelalters anhand der Reenactment-Gruppen und Mittelalterfeste. Für meine Feldforschung schlüpfte ich in mittelalterliche Kostüme und beobachtete Ritterturniere, Schwertkämpfe und Konzerte mit Dudelsäcken. Ein gewagtes Thema eigentlich für eine Abschlussarbeit, denn damals gab es fast keine Sekundärliteratur darüber, und die Zeit für eine Analyse meiner Beobachtungen war äusserst knapp, weil mein Deutsch immer noch eine intensive Redaktion benötigte.
Die Kamera zog mich auch nach dem Studium so sehr in ihren Bann, dass ich an der Summerschool für den ethnografischen Film in Göttingen teilnahm und danach als Quereinsteigerin in die Filmbranche wechselte. Das führte nach zahlreichen Links- und Rechtskurven und vielen Arbeitsstunden in Restaurants, um mich finanziell über Wasser zu halten, zur Gründung einer Filmproduktionsfirma mit Freunden und zur Arbeit als Freelancerin für verschiedene Produktionshäuser. Niemals hätte ich gedacht, dass gerade dieser Weg mich mit dem Know-how ausstatten würde, das ich eines Tages für eine Ausstellung beim Schweizerischen Nationalmuseum brauchen würde. Und doch passierte es und ich kam dorthin, wo ich heute noch arbeite und kulturhistorisches Wissen vermitteln darf.
Volkskunde war für mich Liebe auf den zweiten Blick. Eine Liebe, die bis zum heutigen Tag anhält und mich in meiner Arbeit immer wieder positiv beeinflusst.
Flavio Häner – Objekte sind immer auch Informationsträger

Flavio Häner (1983*) sammelte bereits während des Studiums der Volkskunde/Europäische Ethnologie erste Erfahrungen in der Ausstellungsgestaltung im Pharmaziemuseum der Universität Basel. Während seiner Promotion war er da auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Seit 2018 ist Flavio Häner Verantwortlicher für Kulturgüterschutz des Kantons Basel-Stadt. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seiner Partnerin. Er macht gerne Flussreisen und liebt Brett- und Kartenspiele.
Porträtbild © Andri Pol
Herr Häner, bereits während des Studiums waren Sie im Pharmaziemuseum tätig, heute verantworten Sie den Kulturgüterschutz des Kantons Basel-Stadt. Was fasziniert Sie an der Arbeit mit Sammlungen?
Flavio Häner: Museumsarbeit und die damit verbundene Sammlungstätigkeit sind der Grund, warum ich mich für ein Studium der Volkskunde und der europäischen Ethnologie interessiert habe. Blickt man in die Inventarliste der schützenswerten Kulturgüter der Schweiz, so entdeckt man einen unglaublichen Reichtum: Archive oder Bauernhäuser sind da erfasst, ja sogar Dampfschiffe und ganze Museen. Nahezu alle Aspekte des Lebens werden irgendwo in einem Objekt abgebildet.
Mich interessiert die Vielfalt dieser Objekte, aber auch die Breite der Themen, denen man in einer Sammlung begegnen kann. Das Spektrum der Arbeit ist vielseitig: Wenn man einen Sammlungsraum einrichtet oder einen Notfallplan erstellt, so ist man eher praktisch unterwegs. Es ergeben sich aber im Kontext von Sammlungen immer wieder hochwissenschaftliche Fragestellungen. Und das widerspiegelt sehr schön die Breite des Untersuchungsgebietes der Volkskunde und Europäischen Ethnologie.
Woher kommt die Bedeutung von Sammlungen?
Reden wir von Museumssammlungen, denken viele Leute an alte Sachen, die irgendwo eingelagert sind. Diese Wahrnehmung geht an der eigentlichen Relevanz der Objekte vorbei. Denn Objekte sind immer auch Informationsträger, die mit den Methoden der Europäischen Ethnologie befragt und entziffert werden können.
Die Fotosammlung der SGV wird neu als Kulturgut von nationaler Bedeutung im Schweizerischen Inventar aufgeführt. Was bedeutet das konkret?
Die Sammlung des Fotoarchivs gehört nun zum sogenannten Inventar des Kulturgüterschutzes. Zuallererst ist dies eine Würdigung und Anerkennung der Bedeutung dieses Bestandes. Der Bund sichert zu, dass er sich für den Erhalt einsetzen wird und dass die Fotosammlung im Schadensfall prioritär gerettet würde.
Unter Kulturgüterschutz können sich die wenigsten Menschen konkret etwas vorstellen. Können Sie uns den Begriff kurz erklären?
Der Kulturgüterschutz basiert auf internationalen Abkommen, die nach dem Zweiten Weltkrieg unterzeichnet wurden. Er hat sich zum Ziel gemacht, alle möglichen Massnahmen zu ergreifen, damit identitätsstiftende Objekte für die nachfolgenden Generationen erhalten bleiben. Wir kennen viele Beispiele, wo das leider nicht gelang: Der Brand der Kathedrale von Notre-Dame (2019), der Brand des brasilianischen Nationalmuseums (2018) oder der Einsturz des Stadtarchivs in Köln (2009) zeigen, dass bedeutende Zentren von Kulturgut ohne weiteres Opfer von Zerstörung werden können. Mit dem Kulturgüterschutz werden Massnahmen ergriffen, um derartige Verluste möglichst zu verhindern.
Das Interview führte Sibylle Meier
Isabelle Raboud-Schule – Le musée, terrain de l’ethnologue

Isabelle Raboud-Schüle (*1958) a fait ses études de folklore, musicologie et dialectologie à l‘Université de Neuchâtel. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé pour des musées valaisans et a créé le Musée Valaisan de la vigne et du vin près de Sierre. Dès 1994, elle a travaillé comme conservatrice au Musée Alimentarium de Vevey avant de devenir, en 2006, directrice du musée régional fribourgeois, le Musée gruérien à Bulle.
Porträtbild © Andri Pol
En choisissant de me former en ethnologie, je ne cherchais pas à explorer un monde exotique ni à décrire en détail une communauté isolée. Cette discipline m’a donné des outils pour comprendre comment notre société fonctionne et se définit par ce qui est autre. C’est en faisant des inventaires dans des musées locaux en Valais que j’ai commencé ma vie professionnelle et trouvé mon terrain d’observation. Avec des collections d’objets hors d’usage, le musée semble tourné vers le passé. Or, il nous met en relation avec des temps que nous n’avons pas vécus et répond profondément à des besoins et des questionnements actuels.
La pratique muséale ne laisse pas à l’ethnologue de se spécialiser sur un seul domaine et ne permet souvent pas une approche strictement académique. La responsabilité d’une institution polyvalente exige de prendre soin des collections par des acquisitions, l’inventaire et la documentation. Impossible d’y travailler isolément puisqu’il faut activer tout un réseau scientifique pour éclairer de nombreuses histoires. Toutes ces connaissances sont mises en forme dans les expositions et de nombreuses rencontres avec le public. Le musée d’aujourd’hui est donc une plateforme qui donne accès au patrimoine et transmet des informations validées, tout en permettant au public de participer et d’interagir. Cette apparente banalité du quotidien constitue un riche terrain d’observation participante. En effet, les connaissances historiques s’appuient sur les recherches académiques et des sources écrites, mais l’interaction avec le public permet de comprendre de l’intérieur les processus de patrimonialisation et d’identité.
Quels sont les objets qui devraient être conservés, quels pans de la vie sociale, économique, artistique évoquer par des expositions, quelles histoires raconter ? Ces questions, souvent très simples, sont posées aux responsables de musées. En apportant des réponses, j’ai eu de belles surprises qui m’ont permis d’en apprendre davantage ! Je cite ici deux exemples vécus au Musée gruérien à Bulle.
En compilant des informations publiées de longue date par des historiens sur le thème de la fondue, j’ai suscité en 2006 un petit séisme en terre fribourgeoise. Le rappel de la plus ancienne publication connue de la recette de la fondue, publiée à Zurich en 1699, a pris une importance inhabituelle – et pour certains choquante – dans l’évocation de cette tradition gastronomique. Car elle est perçue actuellement comme profondément constitutive de l’identité du canton que la promotion touristique met en évidence avec délices. Les recettes de fondue que l’on peut lire dans divers livres de cuisine européens au XVIIIe siècle rappellent davantage la notoriété et la réputation commerciale des fromages de Gruyère ou du Parmesan que les habitudes des régions de production. Ainsi la consommation en milieu bourgeois semble contredire l’image romantique du berger qui aurait inventé la recette dans un chalet tiré d’une gravure du XIXe siècle.
Mais alors qui a donc inventé la fondue? S’agit-il de la soupe de Kappel ou plutôt du repas très simple des employés d’alpage, obligés de manger à même une unique casserole? Ces questions, récurrentes dans les médias, trahissent une quête d’une origine, si possible très lointaine et ancrée dans une jolie histoire, empreinte de la simplicité montagnarde célébrée comme une identité nationale. La réalité d’un patrimoine alimentaire, comme pour toute tradition qui se transmet par l’adaptation qu’en fait chaque génération, s’avère bien plus complexe et finalement bien plus intéressante. L’histoire de la fondue nous raconte les évolutions économiques, touristiques et les changements d’habitudes quotidiennes de consommation en Suisse au XXe siècle. La confrontation révèle la force des images construites par la promotion du fromage sur le marché suisse depuis un siècle. Le musée révèle ainsi des points de vue multiples sur cette pratique et leur importance émotionnelle.
Si les questions culinaires sont récurrentes, d’autres thèmes surgissent là où on ne les attend pas. Lorsque l’artiste Lorna Bornand a amené son projet «de mèche» au Musée gruérien, des dessins et des broderies utilisant quelques mèches de cheveux que l’artiste a héritées de son père coiffeur, son travail n’avait qu’un tout petit lien avec les collections du musée: quelques tableaux-souvenirs centenaires, composés de fleurs confectionnées avec les cheveux d’une personne et deux bijoux en cheveux tressés. Était-ce des pièces uniques arrivées par hasard ou les témoins d’une réalité dans la région? Les contacts de l’artiste ont permis de retrouver – et d’exposer – le travail d’artisans contemporains qui réalisent des bijoux en cheveux. Les recherches dans d’autres musées ont permis de cerner une pratique très diffusée de l’Angleterre victorienne jusqu’en Hollande, puis en Suisse au début du XXe siècle. Mais c’est bien durant l’exposition même que des informations précieuses et de nouvelles pièces sont apportées par le public local, qui raconte qu’en ville de Bulle même des artisans coiffeurs arrangeaient les mèches conservées par la famille en tableaux souvenirs de défunts. Des messieurs sont venus montrer des chaînes de montres reçues en fiançailles, des pendentifs faits des cheveux d’une aïeule, des tresses et chevelures d’enfants conservées au plus profond des tiroirs, en avouant qu’ils n’osaient plus montrer cela à personne. Car garder de telles mèches suscite actuellement la répulsion ou du dégoût. Quelques bijoux ont été donnés par la suite au musée, mais la plupart des souvenirs prêtés pour l’exposition ont été repris par leurs propriétaires, toujours profondément sensibles à ce que ces cheveux expriment.
L’interaction entre un projet artistique innovant et des objets méconnus des collections a permis d’éclairer un pan silencieux de la vie locale. Les réactions du public mettent aussi le doigt sur des règles et conventions sociales non dites d’aujourd’hui. Peut-on exposer les cheveux d’une personne? Que suggèrent les mèches (synthétiques) utilisés en grande quantité par l’artiste et que révèlent les réticences exprimées? Quelles sont aujourd’hui les règles qui régissent nos coiffures, les cheveux libres ou attachés, lisses ou crépus, visibles ou cachés par un voile?
La directrice de musée organise tout en observant en permanence et en restant constamment à l’écoute de la société. Le musée devient ainsi un terrain passionnant pour l’ethnologue.
Dominik Landwehr – Wikipedia, Technikgeschichte und Citizen Science

Dominik Landwehr (*1958) ist Kultur- und Medienwissenschafter und lebt in Winterthur. Er hat 1983 sein Studium der Germanistik, Volkskunde und Volksliteratur abgeschlossen, danach als Redaktor bei Radio DRS gearbeitet und war dann als Delegierter des IKRK in Pakistan, Thailand, Rumänien tätig. Nach seinen Auslandaufenthalten war er Leiter der Abteilung Pop und Neue Medien beim Migros-Kulturprozent. Mit 50 Jahren hat er seine Dissertation im Fach Medienwissenschaft an der Uni Basel abgeschlossen. Das Werkzeug der Oral History hilft ihm bei fast all seinen Arbeiten, genauso wie seine Leidenschaft, das Fotografieren, welche er zeitlebens als Autodidakt praktiziert. www.sternenjaeger.ch
Porträtbild © Andri Pol
Bei der Volkskunde bin ich 1980 während meines Studiums eigentlich mehr per Zufall gelandet: Auf der Suche nach einem Nebenfach – ich studierte Germanistik – besuchte ich das Seminar für Volkskunde am Zeltweg. Bald lernte ich auch den Doyen der Zürcher Volkskunde kennen, Professor Arnold Niederer. Er verkörperte ziemlich genau das Gegenteil dessen, was man von einem Universitätsprofessor erwartete.
Die Themen, die hier behandelt wurden, waren erfrischend unakademisch: Es ging um Lebensformen in der Stadt und im Berggebiet, um Tourismus, Wohnen, um Lebensgeschichten und Biografien. In seiner Vorlesung über die Kultur und Mentalität von Süditalien hat uns Arnold Niederer vom Bösen Blick und von den präzisen Beschreibungen Carlo Levis in seinem Buch «Christus kam nur bis Eboli» erzählt.
Vorbilder für uns waren auch Walter Keller und Nikolaus Wyss, die, inspiriert von ihrem Volkskunde-Studium, 1978 die Zeitschrift «Der Alltag» gründeten. Die Ideen dieser Zeit haben mich in meinem späteren Berufsleben geprägt: Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme, Mode mehr als Bekleidung, Reisen mehr als Herumfahren, Hobby mehr als Zeitvertreib.
«Volkskunde ist gehobener Journalismus» – der Satz von Arnold Niederer bringt es auf den Punkt und hat mich ein Leben lang bei meinen verschiedenen Interessen und Projekten begleitet:
• Dazu gehört die Technikgeschichte: Lange habe ich mich mit den Sammlern von kryptologischen Geräten befasst, Schweizer Medienerfindungen wie die Hermes-Baby-Schreibmaschine oder die Bolex-Filmkamera haben mich immer fasziniert.
• Zwei Jahrzehnte lang habe ich mich bei Migros-Kulturprozent mit Themen der Digitalisierung befasst. Immer wieder kam ich dabei auf die Do-it-yourself-Bewegung zurück.
• Citizen Science wurde gerade im Kontext der Beschäftigung mit der Digitalisierung zu einem wichtigen Thema. Auch Wikipedia ist ein Citizen-Science-Projekt.
• Das Interesse an Lebensgeschichten wurde damals geweckt und ist heute noch genauso aktuell.
• Seit 2019 engagiere ich mich ehrenamtlich für die Art Safiental. Als integraler Bestandteil des Projekts bin ich seit zwei Jahren daran, mit Methoden der Oral History einen neuen Zugang zu diesem Tal zu gewinnen, der auch für die Kunst fruchtbar ist.
Trotz meiner lebenslangen Verbindung mit der Volkskunde bin ich erst seit kurzem wieder Mitglied der SGV. Ich glaube, dass dieser Verein eine wichtige Rolle spielen kann – als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Alltag, zwischen Profis und Laien, aber auch als Drehscheibe. Dass sich die SGV vermehrt der Citizen Science zuwenden will, finde ich ein zentrales Anliegen.
Theres Inauen – Ein offenes Ohr für die Klänge der Gegenwart

Theres Inauen (*1985) ist in Appenzell aufgewachsen und lebt in Basel. Sie studierte Kulturanthropologie und Kunstgeschichte an der Universität Basel und war von 2014 bis 2019 wissenschaftliche Assistentin am Seminar für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie der Universität Basel, aktuell ist sie Lehrbeauftragte an der Universität Basel sowie an der Hochschule Luzern Design & Kunst. In ihrem Dissertationsprojekt begleitet sie den Aufbau der Schweizer Stiftung Erbprozent Kultur und fragt nach gegenwärtigen Veränderungsprozessen im Feld der Kulturförderung. Neben der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit kulturpolitischen Themen engagiert sie sich in verschiedenen Kulturprojekten. Wann immer möglich, verbringt sie im Winter einige Wochen in und rund um Mexiko-Stadt.
Porträtbild © Andri Pol
Im April 2020: Seit einigen Wochen flimmert am Neubau des geschlossenen Kunstmuseum Basel folgende Botschaft über den LED-Fries: You Protect Me – I Protect You – Two Metres – Twohundred – 6 Feet – Two Arm’s Length – […] – Haltet Abstand. Der deutsche Künstler Wolfgang Tillmans hatte die Aufforderung Mitte März auf seinem Instagram-Account veröffentlicht, das Kunstmuseum adaptierte den Wortlaut für das Lichtspiel an der Aussenfassade. Während die drei Meter grossen Leuchtbuchstaben über die graue Ziegelsteinwand wandern, beobachte ich an der Strassenkreuzung unmittelbar beim Museum Spaziergänger*innen beim Gespräch im Distanz-Kreis. Das vorbeifahrende Tram ist menschenleer.
MItte Mai 2020: Der Performer und Regisseur Pedro Penim berichtet in der Lecture «Performance Doing It» von seiner bis dato geheimen Passion, im Internet stundenlang die entlegensten Inseln der Welt zu recherchieren. Der Anlass ist von der argentinischen Künstlerin Lola Arias kuratiert, von Theaterhäusern in Frankfurt am Main, München, Hamburg und Basel koproduziert, der portugiesische Künstler performt aus seiner Residency in Rom, das Publikum hat sich aus verschiedenen Zeitzonen ins Zoom-Meeting eingewählt, ich sitze auf dem Sofa @home. Die unvorstellbar weit entfernten Inseln, meine Stube, die bloss ausschnitthaft erkennbaren Küchen, Schlafzimmer und Büros der anderen Zuschauer*innen in dieser und in anderen Städten scheinen während der Dauer der Performance in einem Raum zu verschmelzen. Nach eineinhalb Stunden logge ich mich aus – die momentane Isolation wird im Nachhall des Abends besonders deutlich spürbar.
Ende Oktober 2020: Ich gehe meiner Internet-Passion nach und klicke mich durch Videoclips auf YouTube. In allen Videos, die ich mir heute anschaue und anhöre, wird dasselbe Werk aufgeführt: 4’33’’ des amerikanischen Komponisten John Cage. Die Berliner Philharmoniker, Pianist*innen aus aller Welt oder die österreichische Metal Band Dead Territory interpretieren das Stück, in dem Cage die Musiker*innen auffordert, während vier Minuten und 33 Sekunden ihre Instrumente ruhen zu lassen. Neben einigen Hustern aus dem Publikumsraum oder dem Zurechtrücken eines Notenständers höre ich nun vor allem Geräusche aus meiner Nachbarschaft. Fasziniert von der sichtbaren Anstrengung der Musiker*innen und Dirigent*innen, die ungewöhnliche Stille auszuhalten, klicke ich auf den nächsten Clip.
Vielleicht gerade weil Kultur in der gegenwärtigen Situation nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann – Institutionen sind geschlossen, Tourneen verschoben, Projekte aufgegeben, alles ist abgesagt – scheint sie umso eindringlicher im alltäglichen Leben auf: als leuchtender Kommentar in der Stadt-Nacht, als intensive Begegnung auf dem Laptop-Bildschirm, als überraschender Verstärker der Sounds meiner nächsten Umgebung. Genau diese Momente schaffen Raum für Fragen: Was und wer wird in der (verordneten) Stille plötzlich deutlich hörbar? Wie verschieden und ungleich erleben Menschen in ihrem jeweiligen @home die globale Pandemie? Auf welche Weise können sich Kunst- und Kulturschaffende in diese bisher nicht gekannte Situation, die damit verbundenen gesellschaftlichen Diskurse und Veränderungsprozesse überhaupt einbringen?
In dieser Zeit feiert die Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde das Jubiläum ihres 125-jährigen Bestehens. Ich wünsche ihr für die Zukunft ein offenes Ohr für die Klänge der Gegenwart, berührende Begegnungen über die eigenen Komfortzonen hinweg und neben dem Interesse, gesellschaftlichen Wandel zu befragen, zu beobachten und zu beschreiben, auch eine Portion Mut, selbst lustvoll daran teilzunehmen.
Francis Hildbrand – Dans le train, je suis généralement le seul à regarder par la fenêtre

Francis Hildbrand (*1940) a d‘abord été instituteur à la campagne avant de se consacrer à des études de médecine, dont il est sorti diplômé en 1972. En tant que pilote militaire, il a été aux commandes pendant 30 ans d’un Venom, un avion de chasse monomoteur des Forces aériennes suisses. Durant 40 ans, jusqu‘en 2019, il a dirigé son cabinet de médecine générale à Oron-la-Ville. La fermeture de son cabinet a été filmée dans un documentaire de Marie-Ève Hildbrand: «Les Guérisseurs», 2021. Il s‘intéresse à la vie quotidienne des gens, aux bateaux en bois du Lac Léman, à la musique et à son verger.
Porträtbild © Andri Pol
Monsieur Hildbrand, en tant que médecin généraliste, vous aviez un contact étroit avec les gens. Est-ce l‘une des raisons pour lesquelles vous vous intéressez à la vie quotidienne?
Francis Hildbrand: En tant qu‘étudiant en médecine, j‘étais actif dans un groupe autour du journaliste Bertil Galland, qui a dirigé la publication de l‘Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud (12 volumes, publiés entre 1970 et 1987) – une étude complète du canton de Vaud. Pour deux des volumes, il nous a été demandé de nous intéresser de plus près à la vie quotidienne dans le canton de Vaud. Pour interroger les 348 personnes sélectionnées, nous avons demandé l‘aide de Paul Hugger, alors professeur à Zurich. Il nous a initiés à une méthode d‘entretien totalement nouvelle: nous n‘étions pas censés travailler sur un questionnaire préparé, mais simplement parler aux gens – poser des questions et engager la conversation. C‘est ainsi que sont nés les volumes «Les âges de la vie» et «La vie quotidienne» et c‘est grâce à ce travail que j‘ai rejoint la SSTP. En 1996, avec ma femme Claudine, nous avons organisé à Lausanne une exposition à la Bibliothèque cantonale universitaire pour le centième anniversaire de la SSTP.
De 1997 à 2019, vous avez représenté la Suisse romande au comité de la SSTP en tant que vice-président. Comment la Société est-elle perçue en Suisse romande?
C‘est un sujet délicat, car la SSTP n‘est pas très connue en Suisse romande. Cela pourrait être lié à l‘orientation professionnelle différente des chaires des universités de Zurich et de Neuchâtel. Alors que le professeur Pierre Centlivre à Neuchâtel préférait l‘ethnologie non européenne et aimait étudier les peuples lointains et leurs cultures, le professeur Paul Hugger à Zurich s‘intéressait intensément à la communauté locale et à ses coutumes. Cela n‘a guère intéressé les ethnographes français.
La SSTP est composée de nombreux membres académiques. Comment vivez-vous la société du point de vue d‘un folkloriste profane?
À mon avis, les jeunes membres du comité avaient tendance à être trop intellectualisés dans leurs recherches. Leur approche moderne était souvent difficile à comprendre pour les profanes. Mais ils étaient déterminés à se détacher du «père du folklore» de l‘époque, Paul Hugger, et à suivre leur propre voie. Lorsque j‘ai quitté le comité, j‘ai reçu d‘un ancien membre un dicton du socialiste français Jean Jaurès à emporter avec moi: «La tradition, c‘est la transmission du feu et non l‘adoration des cendres.» Je pense que c‘est une belle image de ce que la SSTP devrait maintenir.
Vous vous intéressez aux traditions et aux coutumes. Qu‘est-ce qui vous fascine dans ces sujets?
Je trouve incroyablement passionnant d‘étudier les gens, leurs traditions et leurs habitudes. Que se passe-t-il pendant les vacances? Que font-ils à Pâques? J‘ai enseigné à mes enfants la coutume de l‘œuf rouge des Roumains et des orthodoxes – les œufs de Pâques rouges. C‘était une façon de leur enseigner que le Christ est ressuscité à Pâques. Il s‘agit d‘un message fondamental transmis par les coutumes traditionnelles – j‘adore cela.
Vous vous passez largement d‘un ordinateur et d’un téléphone portable dans votre vie. Qu‘appréciez-vous dans les formes traditionnelles de communication?
Pendant l‘aviation et ma pratique médicale, je m‘entendais bien avec l‘électronique et suivais régulièrement des cours de perfectionnement. Depuis ma retraite, j‘ai mis un terme à cela et m‘offre le luxe de ne pas dépendre des outils électriques, ni du téléphone portable, ni des courriels. Dans le train, je suis généralement le seul à regarder par la fenêtre. Je préfère encore la conversation entre deux personnes et j‘aime la beauté d‘une lettre écrite à la main avec une plume à encre!
L'entretien a été mené par Sibylle Meier
Nathalie Unternährer – Der Verzicht auf Raum, Zeit und Grenzen

Nathalie Unternährer (*1971) hat in Basel und Rouen Geschichte, Volkskunde und Islamwissenschaften studiert. Sie war an verschiedenen Museen als Ausstellungskuratorin tätig, unter anderem im Stapferhaus Lenzburg und am Schweizerischen Nationalmuseum (in Zürich). Sie leitete das kantonale Museum Nidwalden und wechselte 2010 in die Kulturförderung – als Leiterin des Amts für Kultur des Kantons Nidwalden und Leiterin Kulturförderung des Kantons Luzern. Seit 2014 leitet sie die Abteilung Kultur der Christoph Merian Stiftung in Basel. Anfang 2021 weilte sie in einem halbjährigen Sabbatical in Wien, wo sie zur Stadtwanderin wurde. In ihrer spärlichen Freizeit ist sie gerne in der Natur, liest viel und interessiert sich auch ausserhalb ihres beruflichen Engagements sehr für Kultur.
Porträtbild © Andri Pol
Das Studium der Volkskunde war prägend für mich und meinen beruflichen Werdegang. Die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und ihren kulturellen Praktiken hat mich immer interessiert. Auch das Beobachten und Erfassen von gesellschaftlichen Veränderungen oder veränderten Rahmenbedingungen begleitet mich bis heute.
Als Leiterin einer Kulturförderabteilung ist es meine Aufgabe, aktuelle, den jetzigen Kulturproduktionen angemessene Förderstrukturen zu schaffen. Dazu gehören das laufende Beobachten der Kulturlandschaft, der Kulturschaffenden und des Publikums und die Frage, ob unsere Förderstrukturen den Entwicklungen in der Kultur noch gerecht werden. Zurzeit beschäftigt mich die digitale Transformation im Kulturbereich, die durch die Pandemie einen Schub erhalten hat.
Als der Bundesrat am 16. März 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie einen Lockdown verhängte, stand die Schweiz still. Restaurants, Geschäfte, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Konzertsäle und Museen sowie Schulen mussten schliessen. Im Kulturbereich wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Mitarbeitende von Kulturinstitutionen wurden in Kurzarbeit geschickt. Social Distancing und Home-office lautete das Gebot der Stunde.
Bisher waren Künstler*innen und Kulturschaffende in ihrer Arbeit meist in besonderer Weise auf den direkten Kontakt mit dem Publikum angewiesen; die Begegnungsorte von Produzent*innen und Konsument*innen von Kultur sind Theaterbühnen und Konzertsäle, Museen und Ausstellungsräume sowie andere Schauplätze und Arenen für kulturelle und künstlerische Darbietungen. Der Zugang zu all diesen Orten war allen untersagt – kultureller Stillstand! Nach einer anfänglichen Schockstarre begannen die Kulturschaffenden und -institutionen, nach neuen Räumen und Formen der Vermittlung und Kommunikation mit dem Publikum zu suchen. Der Wegfall etablierter Kulturräume führte dazu, dass vermehrt mit Formen digitaler Kulturproduktion und Kulturvermittlung sowie digitalen Kulturkonsums experimentiert wurde. Verstärkt wurden digitale Technologien und virtuelle Räume genutzt, neue Formen der Inszenierung und Präsentation von Kultur erprobt. Es wurden Online-Führungen durch Ausstellungen angeboten, Konzerte und Theater gestreamt, Workshops am Bildschirm angeboten, Lesungen und Diskussionen über Clubhouse gesendet und digitale Plattformen geschaffen.
Alle nutzten digitale Formate, auch diejenigen, die sich vorher nie oder kaum im digitalen Raum aufgehalten hatten. Und alle hofften, trotz Veranstaltungsverbot und Reisebeschränkungen den Kontakt zum Publikum nicht zu verlieren, zu arbeiten statt Däumchen zu drehen und kulturelle und künstlerische Inhalte ans Publikum zu vermitteln.
Doch wie nachhaltig ist dieser digitale Schub? Gehen nach der Pandemie alle zurück zum Analogen?
Die im Pandemiejahr entstandenen digitalen Projekte kann man in vier Projekttypen einteilen: Digitale Plattformen zur Präsentation und Vermarktung von Kunst, Streamings von Theater, Konzerten und Führungen, interaktive Workshops in Gruppen sowie Diskussions- und Vernetzungsplattformen. Die Analyse ergibt Vor- und Nachteile der digitalen Vermittlung, und es lässt sich festmachen, welche Vorteile einen wirklichen Mehrwert gegenüber der analogen Welt bieten. Zum Beispiel das Auflösen von Raum, Zeit und Grenzen: Auflösen von Raum im Sinne von unendlich mehr Möglichkeiten, Kunst zu präsentieren, und zwar ohne physische Architektur, Auflösen von Zeit im Sinne von Nichtgebundensein an eine Tages- oder Uhrzeit und an Produktionslängen beim Kulturkonsum, Auflösen von Grenzen im Sinne von politischen und sozialen Grenzen. Eine unendliche Fülle an Kultur ist 24 Stunden, 365 Tage im Jahr zugänglich, egal ob man in Göschenen oder in Paris wohnt. Überall ist die Begegnung mit Kunst und Kultur gleich weit, ein paar Mausklicks, entfernt. Demokratisch und egalitär wie noch nie.
Der Umzug ins Digitale hat auch Nachteile. Der digitale Raum kann nicht mithalten, wenn es um Kontaktaufnahmen, zwischenmenschliche Interaktionen und gemeinsames Erleben geht, die auch mit wenig Worten, jedoch mit Gesten und Zeichen funktionieren.
Letztlich geht es nicht ums Ersetzen von Räumen, sondern um das Ergänzen. Der virtuelle Raum ist eine andere Welt, die zusätzliche Möglichkeiten schafft, die es zu nutzen gilt. Die Kulturschaffenden werden deshalb auch nach der Pandemie den digitalen Raum nutzen und ihre Inhalte digital, analog oder auch hybrid anbieten.
Dabei werden sich zwei Herausforderungen als zentral erweisen: Die erste besteht darin, dass Kulturförderstellen ihre Förderpraxen und Richtlinien für digitale Projekte anpassen müssen; sie müssen bereit sein, in «unattraktive», aber kostenintensive digitale Infrastruktur zu investieren. Philippe Bischof, Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, meint denn auch, dass eine Aufgabe künftiger Kulturpolitik sein könnte, alternative, selbstorganisierte Plattformen zu ermöglichen, auf denen die Mittel- und Informationsverteilung, die Produktion und Distribution eigenständig und produzentenfreundlich organisiert werden und die Kulturschaffenden somit nicht mangels Alternativen YouTube, Twitch und Spotify nutzen müssen. Die zweite Herausforderung ist, dass es gelingen muss, neue Exklusivitäten im digitalen Raum herzustellen, damit das Publikum für digitale Inhalte adäquate «Eintrittspreise» bezahlt. Diese Debatte um bezahlte Inhalte im Netz ist nicht neu, im Bereich der Medienberichterstattung wird sie schon seit längerem heftig geführt, ohne dass sich jedoch bisher überzeugende Geschäftsmodelle etabliert hätten.
Meine Aufgabe wird es sein, die Förderung der Stiftung so zu gestalten, dass sich die digitale Transformation weiterhin etabliert.
Andreas Hürsch – Es sind wahre Schätze, welche die SGV hütet

Andreas Hürsch (*1956) hat an der Universität Zürich Vorlesungen in Anglistik, Germanistik und Ethnologie besucht, bevor er eine Schreinerlehre absolvierte. Danach war er als Bühnenschreiner am Theater am Neumarkt Zürich tätig und hat beim Umbau eines alten Bauernhauses im Tösstal mitgewirkt. Es folgte ein Architekturstudium an der ETH Zürich und seit 1997 betreibt er ein eigenes Architekturbüro. Die flüchtige Bekanntschaft mit Hugo Kükelhaus weckte sein Interesse am Handwerk. In seiner Freizeit interessiert er sich für Literatur, Philosophie, Kunst, Musik, Theater und Film.
Porträtbild © Andri Pol
Sie sind im Jahr 2021 zusammen mit Ihrer Frau in die SGV eingetreten. Was hat Sie gereizt, dieser Gesellschaft beizutreten?
Andreas Hürsch: Als Architekt ist mir die SGV als Herausgeberin der Buchserie «Bauernhäuser der Schweiz» ein Begriff. So suchte ich kürzlich nach einem Exemplar über das Tessin, das weder im Buchhandel noch antiquarisch auffindbar ist. Dabei stiess ich auf die Archive der SGV, wo ich alte Filme über Waschtage, Wildheuet und Heutransport im Hinterrhein-Gebiet entdeckte. Diese lebendigen Einblicke in das Leben der 1940er-Jahre sind wahre Schätze, welche die SGV in ihren Archiven hütet! Wir beschlossen, die SGV zu unterstützen.
Diese Archive haben also einen unmittelbaren Nutzen für Sie als Architekt?
Ja, diese alten Bestände haben für uns einen grossen Wert. Vor zwei Jahren haben wir in Splügen ein 500-jähriges Haus gekauft, das wir nun nutzbar machen möchten. Darin befanden sich viele alte Gerätschaften, die wir teilweise dem Walserama in Nufenen als Schenkung zur Verfügung gestellt haben: ein paar Kutscherstiefel, die vermutlich ein Kondukteur der Bernardino-Post trug – oder ein Heuschlitten, wie er in einem der Filme aus dem SGV-
Archiv zu sehen ist.
Gibt es für Sie weitere Bezüge zur Volkskunde?
Das alte, handwerkliche Leben fasziniert mich seit einer prägenden Begegnung mit dem Handwerker, Pädagogen und Schriftsteller Hugo Kükelhaus (1909–1984) in seinem «Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne». Ich begann meine Ausbildung mit einigen Semestern Ethnologie, bevor ich mich auf Rat von Kükelhaus entschied, eine Schreinerlehre zu absolvieren. Danach folgte ein klassisches Architekturstudium an der ETH. Aber schon in meiner Jugend gingen wir während der Ferien oft in die Berge, wo ich das Leben und die Arbeit der Menschen aus nächster Nähe beobachten konnte. Doch als Stadtsohn blieb mir diese Welt letztlich fremd. Heute denke ich, dass diese Lebenswelten nach und nach verlorengehen, weil mit den Menschen auch die Erinnerungen und die spezifischen Kompetenzen aussterben. Hat sich nicht das menschliche Gehirn in grauer Vorzeit in Wechselwirkung mit den handwerklichen Fähigkeiten und Techniken zu dem entwickelt, was es ausmacht? Aus diesem Grund sind die dokumentarischen Filme, Fotografien und schriftlichen Aufnahmen äusserst wertvoll, auch wenn sie das Können der lebendigen Menschen nicht ersetzen.
Was fasziniert Sie an den Fotografien und Filmen aus den SGV-Archiven?
Meine Frau ist Architektur-Fotografin mit Schwerpunkt Denkmalpflege. Sie machte mich auf einen speziellen Charakter der dokumentarischen Filme aufmerksam: Die Menschen hatten damals noch kein Bewusstsein, vor einer Kamera zu stehen, verhielten sich daher sehr unbefangen und haben sich auf ihre Arbeit konzentriert. Kaum ein Blick in die Kamera. Es ist wohl davon auszugehen, dass die Abläufe verändert wurden, damit sie gefilmt werden konnten, jede Beobachtung ist ja teilnehmend. Doch waren die Menschen – wie gesagt – noch relativ «Kamera unbewusst» im Gegensatz zu heute, wo schon Kindergärtner laufend performative Posen einüben.
Von einem Neumitglied interessiert uns natürlich: Was erwarten Sie von der SGV?
Die Buchserie «Bauernhäuser der Schweiz» ist fantastisch, und ich würde mir wünschen, dass man dieses Thema weiterverfolgt. In Graubünden beispielsweise gibt es unendlich viel neues Material seit der Publikation des ersten Bandes der Serie. Denkmalpflegerische Arbeit, ob objekt- oder siedlungsbezogen, wird heute von vielen Kolleginnen und Kollegen sehr ernsthaft betrieben. Die Bände «Bauernhäuser der Schweiz» sind dabei immer erste Referenz bei Diskussionen mit der Denkmalpflege, wenn es um entsprechende Objekte geht. Und ich erlebe beim allgemeinen Publikum einen grösser werdenden Kreis von Menschen, die sich für herkömmliche Lebensweisen interessieren – für Bauten, Traditionen oder auch für Rezepte. Diese Menschen sind empfänglich für die Anliegen der SGV. Dabei finde ich wichtig, dass es sich nicht um rein museale Werte handelt – ich bin überzeugt, dass Menschen, die fähig sind, ihre Umgebung mit eigenen Händen zu gestalten, widerstandsfähiger sind gegen die Vereinnahmungen der massenmedialen modernen Welt.
Sandra Limacher – Auch das Denken dekolonialisieren

Sandra Limacher (*1966) arbeitet in Luzern und Graubünden; seit 2008 ist sie Geschäftsführerin von «WaldKultur – Beratung und Forschung» in den Bereichen Biodiversität, Wald und Ethnoökologie. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die «Baubegleitung» von kantonalen Biodiversitätsstrategien. Für das Bundesamt für Umwelt hat sie die Interessen der Schweiz zur Walderhaltung in internationalen Gremien vertreten und Grossprojekte wie den Aufbau der Biodiversitätsstrategie Schweiz geleitet. Seit 2014 leistet sie als Präsidentin des Fördervereins Forstmuseum Ballenberg einen Beitrag, dass waldrelevantes traditionelles Wissen in der Schweiz bewahrt und vermittelt wird. Sie studierte auf dem zweiten Bildungsweg Forstwirtschaft, Naturschutzbiologie und Wildtiermanagement an der University of British Columbia, Kanada, danach Kulturanthropologie in Oxford; seit 2018 erforscht sie die Rolle und Bedeutung der indigenen Völker zum Erreichen von Nachhaltigkeit.
Porträtbild © Andri Pol
Als sich im Industriegebiet Schweizerhalle am 1. November 1986 ein folgenschwerer Chemieunfall ereignete, war ich zufällig in Basel. Vom ersten Sirenenalarm bis zur Entwarnung der Behörden waren es drei hellwache Stunden – lange genug, um das Leben, die Endlichkeit und den menschlichen Umgang mit der Natur zu reflektieren. Die Katastrophe stellte mein Leben auf den Kopf und die Weichen um. Im Zentrum steht seither die Frage, wie ein sorgfältiger Umgang mit der Natur gelebt werden kann.
Meine Spurensuche begann 1990 in Westkanada. War es Zufall oder Fügung? Mir bot sich die Gelegenheit, sechs Monate auf einer kleinen Insel zwischen Vancouver Island und dem Festland von Britisch Kolumbien zu leben und eine ältere Dame zu betreuen. Auf der Quadra-Insel lebten damals rund 1000 Personen, darunter die We-Wai-Kai beim Cape Mudge mit Chief Assu – eine starke Gemeinschaft. Zu den engen Freundinnen «meiner» Dame gehörten Joy Inglis und Hilary Stewart. Joy war Kulturanthropologin, Hilary war Gründungsmitglied der archäologischen Gesellschaft von Britisch Kolumbien und eine begnadete Illustratorin und Autorin. Beide erforschten die Lebensweise, das Handwerk, die Kunst, das traditionelle Wissen, die rituellen und «sacred» Aspekte der We-Wai-Kai und weiterer Küstenindianer. Es war fast Alltag, dass wir über ihre neuesten Arbeiten hörten oder abends am Strand von We-Wai-Kai in ihre traditionelle Kochtradition eingeführt wurden. Zu sehen und zu hören, wie Küstenindianer mit der Natur umgehen, hat mich nachhaltig geprägt.
Ein Zufall folgte dem anderen. Aus ursprünglich geplanten drei Monaten wurden sieben Jahre in Westkanada. Davon fünf Jahre an der Universität von Britisch Kolumbien, wo wir Studenten in einem interdisziplinären Programm zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen darauf trainiert wurden, den Fokus auf die Schnittstellen zwischen Sektoren und auf das Brückenbauen zu richten (heute heisst das: Silodenken überwinden). Die Erfahrung, Mitte der 1990er-Jahre zusammen mit First-Nations-Studenten in jedem Fach gemeinsam nach nachhaltigen Lösungen zu suchen, hat meinen Blick auf vieles verändert. Vor allem hat es mich wach dafür gemacht, dass die Dekolonialisierung auch im Denken eines jeden Einzelnen und in der Akademie weitergehen muss.
Die Themen Nachhaltigkeit, Wald und Biodiversität beschäftigten mich auch nach meiner Rückkehr in die Schweiz, sei es als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der ETH Zürich oder als International Forest Policy Adviser beim Bundesamt für Umwelt. Es war während einer Verhandlung am UNO-Waldforum, dass ich mich entschied, den Amazonas selbst kennen zu lernen. Die Dimension des Waldes, die Gerüche und Geräusche, aber vor allem die Verbindung der Indigenen mit «ihrem» Wald (sichtbar und unsichtbar) weckten den Ruf, auf den Spuren des amerikanischen Anthropologen Darrell Posey nach Oxford zu gehen, um Kulturanthropologie mit Schwerpunkt Amazonas zu studieren. Wald und Kultur ist seither meine Herzensangelegenheit und gleichzeitig der Name meiner Firma. Ich wurde Mitglied bei der SGV, weil ich Gleichgesinnte in der Schweiz suchte und auch fand. Den Austausch schätze ich sehr.
Michel Massmünster – Vielfältige Zugänge, ambivalente Deutungen und ein Mehr an Leben

Michel Massmünster (*1982) hat in Basel und München Kulturanthropologie und Soziologie studiert. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Nacht, die auch Thema seiner Dissertation war. Er ist derzeit Lehrbeauftragter an der Uni Basel und forscht an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Daneben geht er selbstständig unterschiedlichen Tätigkeiten nach: Er gibt Schreibworkshops, macht Stadtführungen, schreibt journalistisch oder vermittelt Kunst. Neben seiner meist städtischen Forschungsumgebung ist er gerne an Felsen, auf Bergen und in Büchern unterwegs.
Porträtbild © Andri Pol
Durch welche Zufälle und auf welchen Umwegen der Kulturanthropologe und Soziologe Michel Massmünster Volkskunde studiert hat, fragt er sich gelegentlich selbst – die Antworten fallen durchaus ambivalent aus.
Herr Massmünster, war früh klar, dass Sie Volkskunde studieren wollen?
Interessiert hätte mich die Volkskunde schon. Als ich aber vernommen hatte, dass hier Studierende Werkstätten für Schwyzerörgeli besuchen würden, verflog mein Interesse.
Aber dann haben Sie sich doch dafür entschieden? Bewusst entschieden habe ich mich gar nicht.
Ja, klar, das lässt sich erst im Nachhinein so erzählen. Deswegen sind wir hier: Ein Porträt soll entstehen. Also, wo können Sie die Wendung festmachen?
Immer wenn unser Geschichtslehrer im Gymnasium etwas besonders Ergreifendes erzählte, fügte er hinzu: «Das ist jetzt Soziologie.» Bei anderen Fächern, die mir in positiven Momenten begegnet waren, ging es mir aber ähnlich wie bei der Volkskunde. Ebenfalls im Gymi hatte ich begeistert Jack Kerouacs «The Dharma Bums» gelesen.
Kerouac, der hat auch "On the Road" geschrieben: 50er-Jahre, Beat Generation, Roadtrips – diese Romantisierung von Rausch und männlichem Aussenseitertum hat Sie begeistert?
Ja, damals. Es muss auch Brüche geben in einem biografischen Interview, sonst wirkt es langweilig. Ausserdem wollen wir doch nicht ins Muster solcher Heldengeschichten fallen – die Gefahr besteht ja bei Porträts. Jedenfalls hatte Japhy Ryder, der Anti-Held des Buches, «anthropology» studiert. Ich schlug den Begriff im Diktionär und dann die mir nichts sagende Übersetzung im Lexikon nach.
Nicht auf Wikipedia? Das gab es damals noch nicht. Jedenfalls las ich da …
So alt sind Sie schon?
… dass es eine Kultur- und eine Biologische Anthropologie gebe. Auch wenn ich mir wenig darunter vorstellen konnte, eröffnete Ersteres eine Vision, die sich gut anfühlte. Es versprach mehr, als was ich kannte.
Aha, so ein Mehr an Leben, wie es Kerouac beschwört? Das passt ja.
Ich fand damals aber kein Studienfach mit diesem Namen, weshalb ich auch diesem Aufscheinen eines Interesses nicht nachgegangen bin.
Wahrscheinlich war Ihnen nicht bewusst, dass Sie sich überhaupt mit der Studienwahl hätten befassen sollen. Geht ja vielen so. Und die landen dann bei der Volkskunde. Wie lief das bei Ihnen?
Im ersten Semester Soziologie erzählte ich einer Kommilitonin, was mich daran faszinierte: «Weshalb tun Menschen, was sie tun, fühlen sich unterschiedlichen Gruppen zugehörig, gehen an bestimmte Orte und tragen spezifische Kleidung und Zeichen? Welche Bedeutung geben sie diesen Dingen?»
So haben Sie das gesagt?
Nein, ich hatte sicher andere Worte gewählt. Sie haben nun mal danach gefragt. Die Kommilitonin konnte eine Vorstellung entwickeln, was ich ausdrücken wollte und hat mir geraten, mein Nebenfach zu wechseln: Volkskunde.
Aha, jetzt wird es interessant. Durften Sie doch noch eine Schwyzerörgeli–Werkstatt besuchen?
Nein, meine erste Exkursion brachte mich in den Europapark. Immer wieder war ich erstaunt, welche abseitigen Themen dieses Fach aufnimmt.
Ja, ich erinnere mich auch, dass wir als Studierende die thematische Willkür des Faches belächelten. Erst später verstanden wir, dass das Volkskundliche eher in der Betrachtungsweise liegt als im Thema.
Und mir fiel auf, dass mit den neuen Sichtweisen plötzlich auch die Herstellung von Schwyzerörgeli spannend wurde.
Die Kommilitonin behielt also recht mit ihrem Rat. Aus dem Nebenfach wurde bei Ihnen der Major und ein Doktorat. Da haben Sie die Nacht erforscht, also wieder Rausch, Aussenseitertum und Mehr an Leben. Nun haben Sie dies dekonstruiert. Die Nacht verdeutlicht aber auch, wie vielfältig Bezüge auf vermeintlich Gleiches sein können.
Aber davor geschah noch etwas anderes. Mit der Umbenennung des Studienfaches studierte ich plötzlich doch Kulturanthropologie.
Spannende Wendung. Dass die Modelle der Kultur- und Sozialwissenschaften an der Zähmung solcher Zufälligkeiten und vielfältigen Bezügen beteiligt sind, zeigen Sie auch an der Forschungsgeschichte der Stadt und der Nacht. Da geht es um Kontrolle und Macht. Dazu gehört auch die Idee des rational handelnden Menschen. Aber Entscheidungen fallen unbewusst. Apropos, Sie forschen an der Zürcher Hochschule der Künste im Bereich Art Education, wie sind Sie dazu gekommen?
Über meine Auseinandersetzung mit der Nacht arbeitete ich mit Künstler*innen zusammen. Forschung, Feld und Vermittlung fielen zusammen, ich war Ethnograf, Akteur und Erzähler zugleich: Ich sammelte Material, gestaltete die Nacht mit und sprach über mein Verständnis von ihr. Zugänge zum Feld suchen bedeutete, Öffentlichkeit für das Thema zu generieren; Prozesse, die ich wiederum untersucht habe.
Ah, dieses performative Verständnis von Ethnografie? Vermittlung wird oft diskutiert, als hätte die Forschung Erkenntnisse auszudrücken, die sie dann einfach so ausdrückt. Die Wechselwirkungen sind aber beidseitig, ambivalenter und weniger intentional.
Ja, und aufwühlender. Mein Text oder meine Performance bewirken viel mehr, als ich hineinlege – und doch nicht mal jenes, was ich ausdrücken will. Dies führt zu vielschichtigen Aushandlungen.
Angenommen, Sie würden mit sich selbst einen Dialog führen, was würden Sie als Reiz an der SGV beschreiben?
Dieses Potenzial, Öffentlichkeiten zu kreieren. Die kulturanthropologische Perspektive erlaubt es, als gegeben Angenommenes zu hinterfragen, sodass verschiedene Beteiligte unterschiedliche Zugänge finden und sich auf das Leben und Denken anderer einlassen können.
Also ein Mehr an Leben wie bei Kerouac, diesmal durch die Perspektive? Ein schönes Schlusswort, das ich Ihnen hier in den Mund legen konnte.
Vielen Dank für das Gespräch.
Erika Welti – Volkskunde öffnet den Blick für andere Menschen

Erika Welti (*1936) war von 1970 bis 1991 Gemeinde- und Kantonsrätin in Zürich. Ab 1984 leitete sie die Schule für Haushalt und Lebensgestaltung, die aufgrund ihrer Initiative in die Diplommittelschule (DMS) umgewandelt wurde. Sie engagiert sich in der Methodistenkirche und hält auch in ihrem hohen Alter immer noch regelmässig Predigten.
Porträtbild © Andri Pol
Sie haben einen Doktortitel, waren Rektorin einer grossen Schule und als eine der ersten Frauen in der Zürcher Kantonspolitik engagiert. Wurden Sie je an einem Karriere-Schritt gehindert, nur weil Sie eine Frau sind?
Nein, und zwar aus dem einfachen Grund: Ich bin immer mich selber geblieben. Ich durfte schon am Familientisch erleben, dass die eigene Meinung in Diskussionen Gewicht hat. Ich war deshalb nie versucht, «die Männer» zu imitieren. Ab 1970 war ich zusammen mit sieben anderen Frauen in einem 125-köpfigen Gemeinderat tätig – da wurden wir anfangs schon belächelt. Aber wenn eine Frau aufstand und sich erst den «Tschoopen» zuknöpfen und zurechtrücken musste – wie das eben die Männer gerne taten – hat mich das eher amüsiert. Ich musste mich nie wappnen in dieser Form, ich bin einfach hingestanden und habe gesagt, was ich denke. Gleichberechtigung war für mich nichts, was ich mir erkämpfen musste.
Sie haben immer gearbeitet und nebenher studiert. Was hat Sie am Fach Volkskunde gereizt?
Ich habe eigentlich nie aufgehört zu studieren. Ich war im Gymnasium, wurde Primarlehrerin und später Heilpädagogin. Bei der Heilpädagogik geht es sehr darum, wie man mit Menschen umgeht. Das hat letztlich sehr viel mit Volkskunde zu tun, wo uns Bräuche und Traditionen interessieren. Mir ist der psychologische und religiöse Aspekt des Miteinander-Umgehens sehr wichtig. Es interessiert mich, was mein Gegenüber macht und wie es ihm geht. Heute kann ich nicht mehr sagen, was mir Volkskunde bedeutet – sie ist zu einem Teil von mir geworden.
Hat Ihnen Ihr volkskundliches Interesse geholfen, Politik besser zu verstehen?
Ich bin vom Gedanken des Respekts gegenüber anderen geprägt. Ich bin zwar in der EVP, habe aber nie einfach irgendwelche parteipolitischen Parolen nachgebetet. Ich verfolge das, wovon ich denke, dass es richtig und wichtig ist. Die Volkskunde hat mir den Blick für andere Menschen geöffnet. Ich muss niemanden ausgrenzen, weil er dunkle Haut hat oder anderer Überzeugung ist als ich. Gibt es Differenzen, suche ich das Gespräch und erläutere, warum ich anders denke.
Heute stehen die individuellen Bedürfnisse tendenziell über den Bedürfnissen der Gemeinschaft. Wie beurteilen Sie als christliche Politikerin diese Entwicklung?
Es ist ein christliches Prinzip, dass man nicht nur an sich denkt. Doch leider muss ich feststellen, dass das Zwischenmenschliche am Verschwinden ist. Es gibt keine echte Begegnung mehr. Die Menschen gehen nicht mehr mit offenen Augen durchs Leben, viele sind nur noch im Kontakt mit der Elektronik. Dabei lernt man doch nur von der Welt, wenn man den Blick für das öffnet, was einen umgibt. Begegnung heisst für mich, dass man einander in die Augen schauen kann.
Das Interview führte Sibylle Meier
Byron Dowse – Nur eine Momentaufnahme

Byron Dowse (*1997) studiert seit 2017 Kulturanthropologie und Geschichte an der Universität Basel. Als Präsident der Fachgruppe Kulturanthropologie setzt er sich neben der Arbeit und dem Studium auch intensiv mit dem Fach und der Universität bzw. dem Seminar als (politische) Bildungsinstitution auseinander. In seiner Freizeit ist er gerne draussen und bewegt sich. Er macht selber Musik und geht gerne auf Konzerte und Raves. In den letzten zwei Jahren hat er begonnen, sich der Gartenarbeit zu widmen und beschäftigt sich mit dem Konzept der «Permakultur».
Porträtbild © Andri Pol
Während der Recherche für die auf Seite 88 abgebildete Chronik (betrifft das gedruckte Magazin, Anm. d. Reaktion), die ich als Hilfsassistent am Basler Seminar durchgeführt habe, durfte ich zugleich für die SGV einen Beitrag leisten und mich in die Geschichte des Vereins und damit in die von der Volkskunde zum Vielnamenfach gewordene Disziplin vertiefen. Reizvoll war diese Aufgabe für mich einerseits wegen der Fächer Kulturanthropologie und Geschichte, die ich studiere, und meines Interesses für die Fachgeschichte; und andererseits, weil diese historische Perspektive im Rahmen des Jubiläums hilft, die SGV aktuell zu situieren und zu reflektieren.
Jubiläen lassen sich etwa so beschreiben, wie es Sabine Zinn-Thomas, Jörg Giray und Markus Tauschek zum Jubiläum des 50-jährigen Bestehens des Freiburger Instituts im Vorwort der Festschrift getan haben. Sie «[...] bieten Momente der Reflexion und der Selbstvergewisserung. Sie ordnen gegenwärtige Verhältnisse in den historischen Verlauf ein und haben dabei immer auch die Zukunft im Blick. Doch Jubiläen sind [...] nur Momentaufnahmen – das feierliche Innehalten wird rasch wieder abgelöst durch die alltäglichen Rhythmen und Routinen.»
Ich will versuchen, eine solche Momentaufnahme zu skizzieren.
Als Studierender bin ich häufig mit den Unsicherheiten konfrontiert, die mit Aneignung und Anwendung von kulturwissenschaftlichem Wissen einhergehen. «Und was macht man später damit?» lautet eine oft gestellte Frage, und genau so lautet auch der Titel der Masterarbeit Flavio Häners (siehe auch Seite 34), die zeigt, welchen Unsicherheiten auch die SGV ausgesetzt war und noch immer ist. Oft ist für Studierende die Spezifik und Argumentationsweise der Kulturanthropologie herausfordernd. Fachgeschichte hilft didaktisch, die eigene Argumentation zu festigen und zu reflektieren. So ist für mich die SGV ein Ort des Lernens. Wie heutige Wahrnehmungen früherer Projekte zeigen, ist dieses Lernen stets ambivalent. Darin liegt in meinen Augen ein Potenzial der SGV als historische Quelle sowie kultur- und geschichtsvermittelnde Instanz. Kollaboration ist eine Kontinuität der SGV.
Früher waren es «bedrohte Kulturgüter», die späteren Generationen durch ihre Dokumentation erhalten bleiben sollten. Die Dokumentation entstand aus dem gemeinsamen Engagement von Wissenschaftler*innen und zahlreichen Menschen aus der Zivilbevölkerung, die z.B. Befragungen durchführten oder beantworteten. Lernen war dabei sowohl Mittel zum Zweck als auch Ziel. Es bildete sich eine gewisse Expertise innerhalb der SGV für die Kollaboration. Gerade im Angesicht heutiger Forschungstrends wie Open Source und Citizen Science kann das ein Potenzial sein für die Gestaltung gemeinsamen Lernens über Generationen hinweg.
Sinnbildlich dafür stehen die Studierendentagungen, die dank Unterstützung der SGV jedes Jahr stattfinden. Sie stehen sowohl Studierenden als auch Interessierten offen. In dieser Übersetzungs-, Gedächtnis- und Reflexionsarbeit kann die SGV ein Ort für den intergenerationalen Dialog über die Grenzen von Wissenschaft und Gesellschaft hinaus sein. Die SGV trägt so dazu bei, dass Studierende immer wieder wertvolle Lern-, Partizipations- und Anknüpfungsmöglichkeiten erhalten.
Selina Guhl: Gibt es unpopuläre Kulturen?
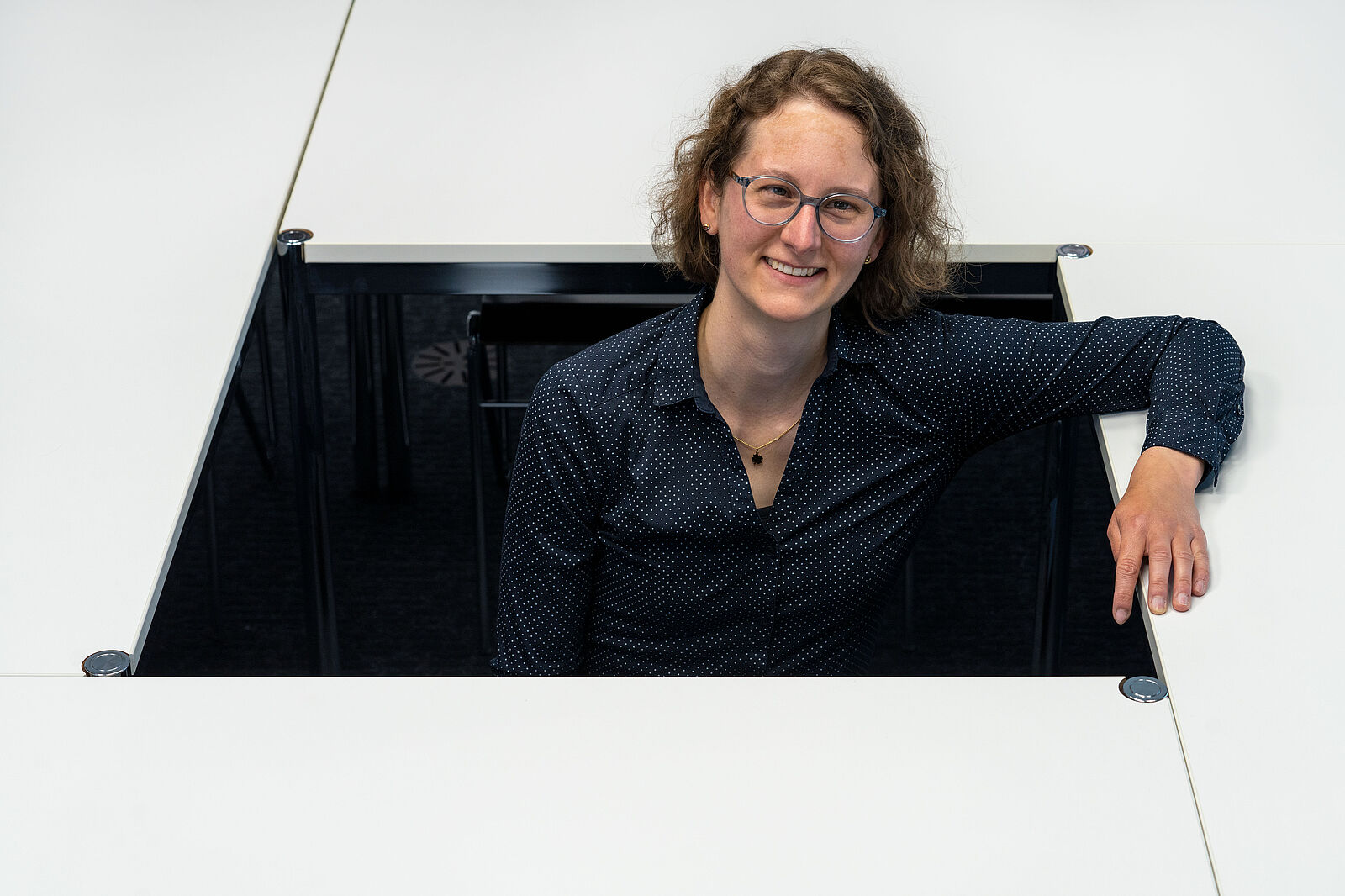
Selina Guhl (*1990) hat an der Universität Zürich Populäre Kulturen, Skandinavistik und Gender Studies studiert und mit einem Master in Sozialwissenschaften abgeschlossen. Sie ist seit sechs Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHAW School of Management and Law, eine der führenden Hochschulen für angewandte Wissenschaften in der Schweiz. Ihre Schwerpunkt-Themen sind Kultur, Gender, Diversität, Kulturmanagement und Hochschulentwicklung. In ihrer Freizeit spielt sie Saxophon und geht leidenschaftlich gerne biken.
Porträtbild © Andri Pol
Bei Recherchen nach einer Studienrichtung, die ich einschlagen könnte, stiess ich 2009 auf das Fach «Populäre Kulturen» der Universität Zürich. Auf den ersten Blick klang der Fachtitel eher befremdlich; wie konnte Kultur populär sein? Und gab es so etwas wie eine «unpopuläre Kultur»? Doch die Beschreibung des Faches sprach mich an, die Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff reizte mich. Aufgrund meines breiten Interessengebiets komplementierte ich mein Studium mit den Fächern «Skandinavistik» und «Gender Studies». Durch das Studium «Populäre Kulturen» kam ich in Kontakt mit der SGV und durfte während meines Masters als studentische Vertretung Teil des Vorstands sein. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand ermöglichte mir weitere Einblicke in die kulturwissenschaftliche Forschung und in die Organisation von Vereinstätigkeiten. Nach dem Masterabschluss musste ich mich leider von der universitären Welt verabschieden, was mir zunächst nicht leichtfiel, liebte ich doch die Auseinandersetzungen mit kulturwissenschaftlichen Fragestellungen, die Diskussionen in den Seminaren und die kritische Reflexion von gesellschaftlichen Phänomenen. Doch eine andere Welt galt es zu entdecken, und so bewarb ich mich bei der ZHAW School of Management and Law und startete als Operations Managerin von Weiterbildungsprogrammen der Abteilung International Business. Ende 2019 übernahm ich neu die stellvertretende Leitung des Weiterbildungsteams der Abteilung und wechselte in den Bereich «Corporate Education». Neu konzipiere ich massgeschneiderte Weiterbildungen für Unternehmen und bin als Projektmanagerin für die Durchführung verantwortlich. Des Weiteren konnte ich meine Liebe zur Wissenschaft wieder vermehrt ausleben. Ich begleite Bachelor- und Masterstudierende bei ihrer Abschlussarbeit, unterrichte wissenschaftliches Arbeiten und beteilige mich an wissenschaftlichen Publikationen. Die direkten Berührungspunkte mit der Volkskunde sind zwar verschwunden, doch das Thema Kultur spielt auch im betriebswirtschaftlichen Umfeld eine grosse Rolle. Welche Unternehmenskultur ist vorherrschend? Welche Herausforderungen gibt es in interkulturellen Teams? Und welche Wertvorstellungen haben Führungskräfte? Ich bin mir sicher, die Brücke zwischen der Volkskunde und der Wirtschaft lässt sich schlagen, durch eine Bereitschaft, transdisziplinär zu denken und auftretenden Phänomenen reflektierend zu begegnen.
Gennaro Ghirardelli: Zwei Sammlungen im Fotoarchiv der SGV

Gennaro Ghirardelli (*1944) hat an der Freien Universität Berlin Philosophie, Ethnologie, Religionsgeschichte/Islamwissenschaft studiert. Nach verschiedenen Lehrtätigkeiten begann er 1971 mit ethnologischer Feldforschung im syrischen Euphratgebiet. 1976 begleitete ihn sein Jugendfreund Georges Müller-Kälin für zwei Monate als Fotograf während seiner weiteren Feldforschungen. In seiner Freizeit interessiert sich Ghirardelli für Literatur, Kunst, Kultur und das Leben und die Gesellschaft überhaupt.
Porträtbild © Andri Pol
Eine Unbekannte mit drei Buchstaben war die SGV für mich zwar nicht, als der Seminarleiter Walter Leimgruber und ich vor einigen Jahren übereinkamen, die Fotosammlung von Georges Müller-Kälin und mir zur Archivierung und Digitalisierung dem Foto-
archiv der SGV in Basel zu übergeben. Da ich jedoch mein Studium und späteres berufliches Leben fast ausschliesslich in Deutschland verbracht hatte, pflegte ich damals noch keine näheren Beziehungen zur Gesellschaft.
Besagte Sammlung (SGV_17) ist aus meinen ethnologischen Feldforschungen in Syrien in den 1970er- und 1980er-Jahren hervorgegangen. Als ich im Zuge der Erfassung und Erschliessung der mehr als 3000 Fotos die Aufgabe übernahm, die für die Datenbank relevanten Informationen zu den Objekten einzuarbeiten, kam es zu einer engeren Zusammenarbeit mit dem Archiv. Dazu finden sich unter archiv.sgv-sstp.ch/collection/sgv_17/all/1 ein Einführungstext mit Erschliessungsprotokoll sowie ein sechsminütiger Videofilm auf YouTube mit meinem Kommentar.
Unkonventioneller gestalteten sich Übergabe, Erfassung und Erschliessung der Sammlung «Familie Ghirardelli-Schelhaas» (SGV_18). Nach dem Tod meiner Mutter Isabelle Ghirardelli-
Dillier fand sich in einem Bücherkarton ein Durcheinander von sieben Fotoalben und losen Objekten, im Ganzen 1355 Positive und 231 nur zum Teil zu den Positiven gehörige Negative nebst einigen weiteren fotohistorisch interessanten Objekten, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Die Sammlung deckt ungefähr den Zeitraum eines Jahrhunderts ab, von den 1880er- bis in die 1980er- Jahre. Nach der Sichtung entschied die Leiterin des Fotoarchivs der SGV, Nicole Peduzzi, den Bestand für das Archiv zu übernehmen.
Im Verlauf eines Seminars, das Nicole Peduzzi im Frühjahrssemester 2018 am Fachbereich Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie der Universität Basel unter dem programmatischen Titel «Der Fall Ghirardelli: Zugänge zur Erschliessung und Erforschung einer fotografischen Sammlung» anbot und zu dem auch ich hinzugezogen wurde, begann meine intensivere Beschäftigung mit diesen Objekten. Dank meiner Kenntnisse zu Personen und Ereignissen der Sammlung und anhand darauf basierender zielgerichteter Recherchen ergab sich im Lauf der Erschliessung ein Narrativ, das auf einen ausgedehnteren sozialhistorischen Hintergrund verweist als ursprünglich hinter der Bezeichnung «Familiensammlung» angenommen. Diesbezüglich relevant ist allein schon die Tatsache, dass alle drei in Zürich ansässigen und durch Heiraten miteinander verbundenen Familien, gewissermassen die «Trägerfamilien» der Sammlung, in ihrer Geschichte einen Migrationshintergrund aufweisen: die Schelhaas im 18. Jahrhundert als Goldschmiede aus dem Raum Kassel in Deutschland; Carlo Ghirardelli sen. im 19. Jahrhundert aus Norditalien, heiratete in die Familie Schelhaas; Josef Dillier, Vater von Isabelle Ghirardelli-Dillier, im 19. Jahrhundert als Rückkehrer einer einst aus Sarnen in die Gegend von Lyon ausgewanderten Familie. Die vertiefte Beschäftigung mit den Objekten und nach weiteren Recherchen sich daraus ergebende Zusammenhänge zeigten zudem, dass der Begriff «Familiensammlung» zu kurz greift: Bei vier der sieben Alben und bei der Mehrzahl der Negative und Positive handelt es sich vielmehr um «Freundschaftsbilder». Sie decken ausgedehnt den gleichen Zeitrahmen ab (1900–1980) wie die in Nora Mathys’ Buch «Fotofreundschaften». Visualisierungen von Nähe und Gemeinschaft in privaten Fotoalben aus der Schweiz 1900–1950 analysierten Beispiele und weisen mit diesen in Habitus, Bildgestaltung und -ästhetik zum Teil eine verblüffende Ähnlichkeit auf. Darüber hinaus beschreiben sie einen fast lückenlosen Lebenslauf zumindest einer Person vom ersten Lebensjahr (1907) bis zum letzten (1984), beleuchten exemplarisch die Geschichte einer Freundschaft mit signifikanten Intervallen von den Jugendjahren bis ins hohe Alter und begleiten mindestens zwei weitere Lebensgeschichten von der Kindheit bis ins Alter. Diese Curricula wurden ebenfalls mithilfe des Kontextwissens über Personen, deren Lebensverhältnisse und damit zusammenhängende Ereignisse rekonstruierbar und dienen der Erschliessung des Bildbestandes.
Die Bearbeitung von SGV_18 muss als «work in progress» gesehen werden. Mit ihrem offenen, unabgeschlossenen Charakter kann die Sammlung als Schulbeispiel dafür dienen, wie ein solcher Bestand zu erhalten und auch als sozialhistorische Quelle zu erschliessen ist – und wie sich im Verlauf der Erschliessung immer weitere Fragen ergeben, die ihrerseits zu neuen Interpretationsmustern führen.
Suzanne Chappaz-Wirthner: Une attention portée aux jeux de masques et à la créativité culturelle

Suzanne Chappaz-Wirthner (*1947) est née à Sion et a fait ses études d‘ethnologie à Neuchâtel. Elle est fascinée par le carnaval et son jeu de masques. Cet intérêt l’a conduite à des collaborations avec le Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, le Musée du Lötschental et le Musée d‘histoire du Valais. Elle a également enseigné aux universités de Neuchâtel, Bâle et Lausanne. Pendant son temps libre, elle aime faire de la randonnée et du jardinage.
Porträtbild © Andri Pol
J’aimerais en préambule remercier le comité de la Société Suisse des Traditions Populaires de m’avoir invitée à célébrer la longévité d’une société dont je suis membre depuis de nombreuses années et de me donner ainsi l’occasion de revenir sur mon parcours d’ethnologue. Un parcours qui a croisé celui de Christine Burckhardt-Seebass que j’aimerais remercier ici de l’amitié qu’elle m’a témoignée en m’associant à la journée du centenaire de la société, organisée le 8 juin 1996 à l’hôtel de ville de Bâle en présence de Hermann Bausinger.
J’ai fait mes études au début des années septante à l’Institut d’ethnologie de Neuchâtel, connu pour sa collaboration étroite avec le Musée d’Ethnographie. Ces institutions furent parmi les premières en Suisse à remettre en question la césure idéologique héritée du 19ème siècle, entre une Volkskunde assignée à l’étude des «peuples nationaux» européens et une Völkerkunde à laquelle était impartie celle des «autres peuples». J’y ai bénéficié, grâce aux professeurs Jean Gabus et Pierre Centlivres, d’une grande liberté intellectuelle dans le choix de mes objets de recherche. En voici quelques exemples.
Ma première enquête de terrain eut lieu dans le Lötschental. Elle consista en une étude critique des exégèses multiples dont furent l’objet les emblématiques Roitschäggättä, ce qui me fit découvrir l’existence du phénomène de «rétroaction»et les travaux des ethnologues bâlois (L. Rütimeyer, K. Meuli, R. Wildhaber) et zurichois (R. Weiss, A. Niederer, P. Hugger) ainsi que les publications de l’Institut Ludwig-Uhland à Tübingen sur le carnaval, dans la revue Volksleben en particulier. Je pus ainsi évaluer l’incidence des interprétations savantes projetées sur cette pratique alpine par les élites urbaines, diffusées par les médias et intériorisées par les sculpteurs et les porteurs de masques. Un retour sur le terrain trente ans plus tard, en compagnie de Grégoire Mayor, aujourd’hui co-directeur du Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, nous permit d’approfondir, à partir d’entretiens filmés, l’analyse de ce phénomène et, en mettant l’accent sur la façon dont les acteurs du carnaval eux-mêmes qualifient leur pratique et conviennent de ce qui est «typique», «archaïque» ou «moderne», de constater que loin de se limiter à la réception passive des projections savantes et médiatiques, ce phénomène prend la forme d’un jeu d’appropriation différenciée, source de créativité culturelle et sociale. Cette critique épistémologique des notions de «peuple» et de «tradition populaire» m’amena à collaborer avec les ethnologues Thomas Antonietti et Werner Bellwald ainsi qu’avec le Musée du Lötschental et le Musée d’histoire du Valais.
Ces premières recherches générèrent une question qui fit l’objet des nouvelles enquêtes que j’effectuai dans les années quatre-vingt dans le Haut-Valais: quel rôle l’imaginaire carnavalesque joue-t-il dans la construction d’une identité collective? La région de Brigue, Glis et Naters offrait à cet égard un champ d’étude idéal: trois collectivités contigües, aux relations historiques marquées par une succession de scissions et de fusions de paroisses et de communes et par des rivalités économiques et politiques incessantes, devant appliquer sur leur territoire les lois fédérales d’aménagement du territoire et collaborer au sein de la même «région socio-économique». L’étude des circonstances dans lesquelles apparurent les trois sociétés qui avaient pris en main l’organisation du carnaval, le Türkenbund à Brigue, la Bäjizunft à Glis et les Drachentöter à Naters, ainsi que l’analyse des relations paradoxales qu’elles établirent entre elles, alternant rivalités affichées et collaborations forcées, m’amena à voir, dans les emblèmes carnavalesques dont chacune se dota, le traitement rituel des tensions relevées entre la défense des singularités communales et la nécessité de les dépasser pour coopérer au sein de la nouvelle entité administrative, comme si l’imaginaire carnavalesque leur donnait les figures pour dessiner une région idéale affûtant les clivages communaux tout en les englobant sans les nier, tel un modèle imaginé sur la scène rituelle présentant aux collectivités impliquées une solution à leur réalité conflictuelle.
Ces recherches sur le processus identitaire, sur sa dimension historique, relationnelle et différenciée ainsi que sur le choix des critères censés définir la représentativité d’une pratique sociale dans le cadre des entreprises patrimoniales contemporaines, m’amena à proposer au comité cantonal chargé de dresser l’inventaire du patrimoine culturel immatériel valaisan d’y inscrire «l’italianità», au même titre que les consortages ou le savoir-faire lié aux avalanches, afin que soit pris en compte le rôle essentiel que la migration italienne a joué dans l’essor de l’artisanat, de la vie culturelle et de la construction en Valais, qu’il s’agisse de l’architecture et de la décoration d’églises, du creusement des tunnels ou de la construction des barrages hydro-électriques.
Grâce aux cours donnés aux universités de Neuchâtel, Bâle et Lausanne, j’ai pu élargir mes horizons de recherche. À partir de la notion de masque, je me suis interrogée plus largement sur la représentation elle-même, sur son ambiguïté constitutive ainsi que sur la nature et le statut attribués aux images (idole, icône, fétiche ou simulacre?) en fonction des contextes historiques, culturels et sociaux dans lesquels elles sont produites, diffusées, interprétées. Ces questions m’ont permis d’établir des liens entre le monde de l’art et celui de l’ethnographie et ont nourri un enseignement de plusieurs années à l’école cantonale d’art du Valais. Et c’est dans cette direction que mon parcours d’ethnologue se poursuit aujourd’hui.
Ernst J. Huber: Die Bibliothek war für mich nie nur Arbeit, sondern immer auch Leidenschaft

Ernst J. Huber (*1952) wuchs in Münchenstein auf und schloss sein Studium an der Universität Basel mit einem Lizentiat in Volkskunde ab. Studienbegleitend war er zwei Jahre lang Hilfsassistent von
Dr. Theo Gantner im damaligen Schweizerischen Museum für Volkskunde. Von 1982 bis 2017 diente Ernst J. Huber der Volkskunde in verschiedensten Funktionen: als Sekretär, Buchhalter, Verlagsassistent und Bibliothekar im Seminar für Volkskunde der Universität Basel und im Institut der SGV sowie als Mitglied der Redaktion des Schweizerischen Archivs für Volkskunde (SAVk).
Porträtbild © Andri Pol
Herr Huber, Ihr beruflicher Werdegang ist eng verknüpft mit den Tätigkeiten der SGV, Sie waren auch am ehemaligen Schweizerischen Museum für Volkskunde engagiert. Welche Rolle spielen Museen bei der Vermittlung der Populärkultur?
Ernst J. Huber: Über die vielen Jahre hinweg beobachte ich einen Wandel. Früher hat sich dieses Volkskunde-Museum mit Alltagsphänomenen beschäftigt. Mit dem Leben der Bauern beispielsweise, die sich auf den Äckern abgerackert haben, um das Volk mit Nahrung zu versorgen, mit häuslichem Wandschmuck. Heute liegt der Fokus eher auf ausser-europäischer Ethnologie. Was dort gezeigt wird, nenne ich «Sonntags-Ausstellungen»: Präsentiert wird das Endprodukt, aufwendige Stickereien beispielsweise, oder edle Kostüme. Wie diese jedoch hergestellt wurden, das ist anscheinend nicht von Bedeutung und wird uns nicht gezeigt. Die Populärkultur, die mir am Herzen liegt, wird heute vor allem von Regionalmuseen oder Historischen Museen gesammelt und ausgestellt.
Wie hat sich die SGV in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
Die SGV hat Mühe, ihre Mitglieder zu halten oder gar neue zu begeistern. Das war früher anders, da gab es noch richtige Mitgliederwerbeaktionen: Wer am meisten Mitglieder anwerben konnte, bekam einen Zinnbecher! Heute treten zwar viele Studentinnen und Studenten der SGV bei, sie verlassen uns aber nach Abschluss des Studiums. Darum ist unser Verein leider überaltert. Auch die Publikationstätigkeit der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde hat nicht mehr dasselbe Gewicht wie früher. Dabei sind es gerade diese Publikationen, die viele Mitglieder an die SGV gebunden haben.
Sie sind mit Leib und Seele ein Volkskundler. Es scheint so, als kenne niemand die SGV so gut wie Sie – woher dieses Wissen?
Es freut mich natürlich, dass man mein Engagement und meine Liebe zur Volkskunde wahrnimmt. Meine Tätigkeit in der Instituts-Bibliothek am Rheinsprung in Basel war nie nur Arbeit, sondern immer auch Leidenschaft. Dank meiner langjährigen Arbeit als Schweizer Redaktor der «Internationalen Volkskundlichen Bibliographie» hatte ich einen breiten Überblick über die entsprechende Literatur in der Schweiz gewonnen. Mit der Zeit kannte ich die Bedürfnisse der «Kunden» – schliesslich hatte ich wohl jedes Buch der Bibliothek mindestens einmal in der Hand und konnte so meistens weiterhelfen.
Das Interview führte Sibylle Meier
Regina F. Bendix: Der Yogi von Seelisberg

Regina F. Bendix (*1958) ist in Brugg im Aargau geboren. Nach drei Semestern Studium an der Uni Zürich ist sie in die USA gezogen, wo sie 21 Jahre verbracht hat. Sie hat im Fach Folklore promoviert und Germanistik und Kulturanthropologie als Nebenfächer studiert. Seit 2001 ist sie Professorin in Göttingen. Ihre Forschungsinteressen sind ziemlich breit angelegt – das ist auch der Grund, warum sie das Fach liebt: Man kann aus volkskundlicher Perspektive so ziemlich alles beforschen. Als Ausgleich zur Kopfarbeit kocht sie gerne Konfitüre und backt und geniesst es, dass etwas Konkretes dabei entsteht. Gerne schaut sie sich auch Serien an – bis hin zum Binge-Watching. Sie pflegt seit 12 Jahren mit einer Freundin einen monatlichen Serien-Abend, kombiniert mit einander bekochen.
Portrait © Andri Pol
Neulich fiel mir ein Exemplar des Korrespondenzblattes der SGV in die Hände: Das Heft 7/9, 5. Jahrgang, 1915, befindet sich in der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, wohin es mich mittlerweile verschlagen hat. Und dieses Heft enthält eine vollständig abgedruckte Liste aller SGV-Mitglieder. Professoren und Bibliothekare sind da aufgeführt, aber auch Lehrer, Pfarrer, Ärzte, Architekten, Kantons- und Regierungsräte, Ingenieure, Buchdrucker, Journalisten. Sogar einen Zigarrengeschäftsinhaber habe ich entdeckt, und einen Landammann. Wenn ich hier das generische Maskulinum verwende, so hängt dies damit zusammen, dass sich damals mit grösster Wahrscheinlichkeit hinter den mit Initialen abgekürzten Vornamen kaum Frauen verbargen. Die SGV war und ist eine breit aufgestellte Institution mit stattlichen Mitgliederzahlen: Selbst im Kriegsjahr 1944 gab es 63 Neueintritte und eine Gesamtzahl von 731 zahlenden Mitgliedern. Über 60 Institutionen, darunter die Bodleian Library in Oxford und die Bibliothek der Harvard University, bezogen die Publikationen unserer Gesellschaft.
Über meinen Studienwechsel von der Universität Zürich, wo ich 1978 zu studieren begann, an die University of California habe ich zur SGV gefunden. Als Auslandschweizerin und Folklore-Studentin boten die Artikel und Buchbesprechungen im Schweizerischen Archiv für Volkskunde eine Verbindung zur europäischen Forschung. Die Wertschätzung der «Heimat» ging quasi einher mit meinem Wegzug aus der Schweiz. Als ich im Sommer 1983 bei Christine Burckhardt-Seebass in Basel ein Praktikum im Volksliedarchiv antrat, stiess ich in den Archivräumen auf Hans Trümpys Publikationen – etwa die Ciba-Geigy-Hefte – und begann so, das Selbstverständnis der SGV zu verstehen: das Zusammenspiel von aktiver Teilhabe an kulturellen Bildungsangeboten, sammelnder Neugierde und finanzieller Unterstützung von Forschungsprojekten. Heute verlaufen solche Sammelaktivitäten meist digital und losgelöst von kulturwissenschaftlichen Fachgesellschaften. Umso erstaunlicher ist es, dass es der SGV immer wieder gelang, Sammeln und Forschen über Grossprojekte mitzusteuern.
In der Bibliothek von Berkeley gab es alle Jahrgänge von Folklore Suisse/Schweizer Volkskunde und dem Schweizerischen Archiv für Volkskunde – genauso wie ich sie später auch in Bloomington, Indiana, und in der Bibliothek der University of Pennsylvania in Philadelphia finden konnte. Alan Dundes, mein Mentor in Berkeley, führte das Archiv als eine der seriösen Fachzeitschriften der internationalen Folkloristik auf, welche man – neben vielen anderen – für ein grosses Bibliographieren-Projekt in seinem graduierten Seminar zu durchkämmen hatte. 21 Jahre verbrachte ich in den USA, und die Publikationen der SGV waren treue Begleiterinnen. Als mittlerweile auch an der institutionellen Fachgeschichte interessierte Wissenschaftlerin ist für mich das Korrespondenzblatt eine faszinierende Quelle an der Schnittstelle von akademischer Forschung und Citizen Science.
Als Auslandschweizerin habe ich nur zweimal an einer Jahrestagung der SGV teilnehmen können, und diese erwiesen sich als erheblich anders als die amerikanischen Fachtagungen, die ich ab 1980 kennenlernte. Während dort zeitgleich verschiedene Panels angeboten werden, fokussierte sich die SGV auf einen einzigen Vortrag. Wissenschaftliche Arbeiten der Schweizer Fachkolleginnen und -kollegen werden wohl eher bei den Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde vorgetragen. Dafür pflegte die SGV das Reisen und die Exkursionen, was wiederum dem Miteinander der vielen Mitglieder unterschiedlichster Herkunft entspricht. Neben einer mit zahlreichen Grappa-Verkostungen veredelten Tessin-Exkursion ist mir der von Theo Gantner, damals Leiter des Schweizerichen Museums für Volkskunde geleitete Besuch bei Maharishi Mahesh Yogi in Seelisberg tief in Erinnerung geblieben. Während der geschniegelte Geschäftsführer des für uns unsichtbar bleibenden Yogis über die gute Passung von Innerschweizer Sagen und die vor allem gut betuchten Geschäftsleuten zukommende Yogi-Aura berichtete, staunte ich über eine SGV, die auf diese Weise ihren Mitgliedern die Transformation verlebter Hotelkultur in eine geschäftstüchtige, globale Meditationszentrale zu zeigen wusste. Der Maharishi entschwand zwar wieder aus Seelisberg, wie es sich für die gegenwärtige Mobilität des Spirituellen gehört. Für mich war dieses Erlebnis der Tatbeweis, dass die SGV und meine Disziplin topaktuelle Themen verhandelt.
Josef Muheim-Büeler: Ein Stier mit Namen Sozi

Josef Muheim-Büeler (*1941) ist in Schattdorf geboren und wohnt seit 1942 in Greppen. Er hat bis zur Übergabe an seinen Sohn einen Bauernhof geführt und war als Gemeinde- und Kantonsrat tätig. Seit 1956 forscht er zu Genealogien, Lokalhistorik oder verschwundenen Wörtern. Dazu hat er sich eine ansehnliche Fachbibliothek zugelegt. Das Wort Freizeit kommt in seinem Wortschatz eher nicht vor, es sei denn man betrachtet seine historischen Arbeiten und seine Mitarbeit auf dem Hof als Freizeit. Er ist seit 1977 Mitglied der SGV und schätzt den Austausch mit Gleichgesinnten.
Porträtbild © Andri Pol
Seit der Schulentlassung anno 1956 habe ich mich neben meinem Beruf als Landwirt intensiv mit Familienforschung befasst. Dann wollte ich auch wissen, wer früher auf unserem «Bühlhof» lebte und arbeitete. Diese Arbeit weitete sich bald auf die ganze Gemeinde aus. Ich trat zahlreichen historischen Institutionen bei, um mich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Die meisten von ihnen warteten mit jährlicher Fachliteratur auf. Dabei stiess ich auf die rege Publikationstätigkeit der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. Sie faszinierte mich. Die Beiträge von Walter Heim, Alois Senti, Max Felchlin, Urspeter Schelbert, Brigitte Geiser, Karl Imfeld und weiteren Autorinnen und Autoren hatten mein Interesse geweckt. Bald wagte ich es mit einem Beitrag im Korrespondenzblatt «Schweizer Volkskunde» (1978, Heft 6/109) mit dem Titel «Die schwarze Tafel». Dieses Stichwort entnahm ich aus Eintragungen im Ratsprotokoll von Küssnacht am Rigi in den Jahren 1820 bis 1824. Später erzählte ich aus meiner Praxis über den «Wert von mündlichen Überlieferungen» (1986, Heft 5/69). Hier zeigte ich auf, wie schriftliche Quellen und mündliche Aussagen sich gegenseitig ergänzen können. Mit dem Schreiben einer Chronik für eine Viehzuchtgenossenschaft stiess ich auf «Zeitgeschichte im Viehstall» (1987, Heft 4/60). Wie zum Beispiel der Stier mit dem Namen «Sozi», der am Wahlsonntag vom 11. Mai 1919 geboren wurde, als die Sozialdemokraten im Kanton Luzern ihre Sitze im Parlament von 7 auf 11 Mandate steigern konnten. Solche Quellen sind «Volkskunde pur».
Auf der Suche nach Stoff für die «Schweizer Volkskunde» rief SGV-Präsident Dr. Hans Schnyder 1988 (Heft 1/14) zu einem Wettbewerb auf. Ich beteiligte mich mit einer Abhandlung über den «3. Fluh-Schwinget und Chatzästreblä» in Küssnacht am Rigi. Diese Arbeit wurde 1989 (Heft 2/3/17-27) veröffentlicht. Die Etymologie zum «Chatzästreblä» fand im folgenden Heft (4/62) Ergänzungen durch den Namenkundler Dr. Rudolf J. Ramseyer (1923–2007). Der Austausch zwischen Fachleuten und Laien war inspirierend. Volkskunde fand ich nicht allein in der Geschichte, sondern auch in der Gegenwart spannend. Viele Dörfer erlebten in jüngster Zeit gesellschaftliche Umbrüche; Beizen, Vereine und Bräuche begannen zu verschwinden. Ich wünsche unserer Gesellschaft SGV aktive Beobachter, welche die Veränderungen im Volksleben verfolgen und registrieren. Und dass die digitalen «Newsletter» an Stelle der stillgelegten «Schweizer Volkskunde» die Funktion einer Plattform übernehmen, auf der wir uns weiterhin austauschen können. Denn die Arbeit geht uns nicht aus und soll im Dienste unserer Nachwelt stehen.
Ursula Brunold-Bigler: Geschichten sind immer mit der Geschichte verstrickt

Ursula Brunold-Bigler (*1950) hat an der Universität Basel Volkskunde, Schweizergeschichte und Allgemeine Neue Geschichte studiert und 1976 mit einem Lizentiat über Sterbebildchen (populäre Druckgrafik) abgeschlossen. Anschliessend zog sie nach Graubünden und promovierte zum Thema «Religiöse Volkskalender der Schweiz». Seit 1986 beschäftigt sie sich inentsiv mit der historisch-volkskundlichen Erzählforschung sowie der Sagen- und Märchenkultur Graubündens und des Alpenraums.
Porträtbild © Andri Pol
Frau Brunold, Sie haben in Basel studiert und leben nun schon lange in Graubünden. Sehen Sie einen Unterschied zwischen ländlicher und städtischer Volkskunde?
Ursula Brunold-Bigler: Aus meiner Sicht besteht kein Unterschied zwischen städtischer und ländlicher Volkskunde. Sowohl in der Stadt als auch auf dem Dorf kann man Menschen beispielsweise nach ihrer Einstellung zu Zugewanderten befragen. Und genauso kann man Zugewanderte in der Stadt und in den Dörfern über ihre Befindlichkeiten und Handlungsspielräume am neuen Lebensmittelpunkt befragen.
In Ihrer Forschung widmen Sie sich auch den Märchen. Was fasziniert Sie an diesem Thema?
Die leidvolle Geschichte meiner Grosseltern hat mich geprägt. Sie lebten in einer Kellerwohnung mit Algen- und Schimmelbewuchs, litten unter dem Textilproletariat und hatten keine ökonomische Perspektive. Ihr schwieriges Leben hat mein Interesse an Geschichten, die ja immer mit der Geschichte verstrickt sind, schon als Kind geweckt. Aufgrund harter historischer Fakten ergeben sich spannende Fragestellungen: Wie werden prekäre Lebensverhältnisse erzählerisch dargestellt? Gab es soziale und familiäre Konflikte? Wurden Frauen und Randgruppen diskriminiert? Es ist faszinierend, immer neue Fragen an alte Materialien zu stellen. Und Märchen bieten da ein interessantes Forschungsfeld.
Beim «Rotkäppchen und der Wolf» erfahren wir ja viel über den Alltag der Menschen zu jener Zeit. Welche Wirkung haben solche Geschichten auf die Menschen?
Zweifellos hat das äusserst beliebte Rotkäppchen-Märchen Generationen von Kindern geprägt. Beachtenswert ist jeweils der Schluss der Geschichte: Bei den Brüdern Grimm kommt es zu einem glücklichen Ende dank des Eingreifens eines Jägers. Als Repräsentant der Zivilisation vermag dieser den Wolf, der die Wildnis verkörpert, zu beseitigen und somit die gestörte Ordnung wieder herzustellen.
In Charles Perraults literarischer Erstfassung «Le Chaperon rouge» von 1697 sterben die vom Wolf Gefressenen, während der Mörder am Leben bleibt und sein Unwesen weiterhin treibt. Das ebenfalls negative Wolfsbild Perraults ist sexualisiert, der Wolf steht für einen zärtlich werbenden, doch hinterlistigen Mann, der ein unvorsichtiges Mädchen samt seiner unschuldigen Grossmutter ins Verderben führt. Die Zuordnung des Wolfs zu einer als Laster gezeichneten Sexualität findet sich schon in antiken, frühchristlichen und mittelalterlichen literarischen und ikonographischen Quellen. Nichts wird kontinuierlicher und beflissener tradiert als menschen- und tierverachtende Imaginationen.
Ihr Interesse gilt auch der Flora und Fauna, aktuell arbeiten Sie an einem Buch über historische und aktuelle Heilpflanzennutzung in Graubünden. Was sagen Pflanzen und Tiere über den Menschen aus?
Als Volkskundlerin interessiert mich die sich stets wandelnde Wahrnehmung von Pflanzen und Tieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: In der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre holten sich Fabrik- und Heimarbeiterinnen grosse Mengen von Zimmerlinden und Mottenkönigen in die Stube ihrer spärlich möblierten Arbeiterwohnungen. Sie wollten damit die Leere der Armut ausfüllen. Diese Wohnungen glichen einem Gewächshaus. Heute verwandeln trendbewusste Menschen ihre Wohnung auch in ein Gewächshaus – nicht aus Armut, sondern aus dem Bedürfnis heraus, möglichst viel «Natur» um sich zu haben.
Das Interview führte Sibylle Meier
Roland Inauen: Die Volkskunde hat mir geholfen, die Menschen und ihre alltäglichen Bedürfnisse besser zu verstehen

Roland Inauen (*1955) hat an der Universität Basel Volkskunde, Soziologie und Neuere Deutsche Literaturwissenschaft studiert. Er war Leiter des Museums Appenzell (1992–2020) und Leiter des Kulturamts Appenzell Innerrhoden. (1999–2013). Nebenamtlich war er am Bezirksgericht Appenzell und am Kantonsgericht Appenzell Innerrhoden tätig. Seit 2013 ist Roland Inauen Landammann und Vorsteher des Erziehungsdepartements des Kantons
Appenzell Innerrhoden.
Porträtbild © Andri Pol
Herr Inauen, 28 Jahre lang leiteten Sie das Museum Appenzell, in dem die populäre Alltagskultur einen hohen Stellenwert hat. Was war Ihr wichtigstes Ziel als Museumsleiter und Kulturvermittler?
Roland Inauen: Die Gründerväter des Museums wollten die letzten Altertümer des Kantons retten, Objekte wie Fahnen oder religiöse Kunst aus den umliegenden Kirchen. Alltägliches oder aus ihrer Sicht Banales hatte sie nicht interessiert. Als ich 1992 zum Leiter des Museums gewählt wurde, spielte die Alltagskultur praktisch keine Rolle – und genau dieses Defizit haben wir zum Thema zahlreicher Ausstellungen gemacht. Wir haben zum Beispiel Ausstellungen zu Schürzen oder zu Taschentüchern realisiert, und die Leute konnten ihre eigenen Objekte ins Museum bringen. Wir haben aber auch ganz andere Themen aus dem Alltag der Menschen aufgegriffen: Die Ausstellungen «Bienenfleiss-honigsüss» oder «Chomm giz giz giz» beispielsweise haben wir der Kultur- und Naturgeschichte der Honigbiene bzw. der Appenzeller Ziege gewidmet. Im Zusammenhang mit unseren Ausstellungs- und Vermittlungsaktivitäten ist die Sammlung – insbesondere auch im Bereich der Fotografie – dann buchstäblich explodiert.
Wie lässt sich Volkskunst von der zeitgenössischen Kunst abgrenzen?
Wir haben diese Unterscheidung gar nicht gemacht. Meine – zugegebenermassen gewagte – These ist die, dass jede gute Kunst irgendwann zu «Volkskunst» wird. Wir hatten im Dorf Appenzell einen Künstler, der war in den 1930er-Jahren arbeitslos. In der Folge hat ihm sein Schwiegervater sozusagen aus Mitleid den Auftrag erteilt, die Fassaden seines Hauses an der Hauptgasse mit Figuren und Ornamenten zu bemalen. Das hat den Leuten so gut gefallen, dass er immer mehr Aufträge erhielt. So wurde das Dorfbild von Appenzell völlig neu definiert und wurde zur Attraktion für Touristen und Einheimische. Kaum jemand erinnert sich heute an den Künstler Johannes Hugentobler. Seine Kunst wurde nach und nach als namenlose «Volkskunst» rezipiert, die von Epigonen und Flachmalern fleissig kopiert und weiterverbreitet wurde.
Kultur ist ein wesentliches Element für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Durch die Corona-Pandemie ist dieser Kitt brüchig geworden. Wo können Sie als Bildungs- und Kulturpolitiker hier unterstützend wirken?
Die Kulturpolitik konnte die Kulturschaffenden und Kulturunternehmen mit Ausfallentschädigungen unterstützen – das hat funktioniert. Was mir jedoch Sorgen bereitet, ist die Laienkultur: unsere Chöre, Blasmusiken, Trachtenvereine. Wir haben in Appenzell eine grosse Vereinsdichte mit einer reichhaltigen Volkskultur. All diese Vereine müssen ohne Unterstützung auskommen und von Mitgliederbeiträgen leben. Gesellschaftlich aktive Menschen, aber auch die Wirtshäuser als Treffpunkte, sind prägende, verbindende Elemente unseres Kantons. Die ländliche Volkskultur gilt offensichtlich wirtschaftlich nicht als relevant, sie hat aber unter dieser Pandemie enorm gelitten. Die Folgen sind vielfältig. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass sehr vernünftige Menschen mangels sozialer Kontakte und kultureller Betätigung plötzlich in eine Blase geraten, die sie in den sozialen Medien finden, und irgendwelche abstrusen Theorien verbreiten und anfällig werden auf Botschaften von Verschwörungstheoretikern. Da bin ich froh, dass ich als Volkskundler einen entsprechenden historischen Rucksack mitbringe und als Politiker gegebenenfalls gegensteuern kann.
Hat Ihnen Ihre volkskundliche Ausbildung auch bei Ihren anderen Tätigkeiten im Kanton geholfen?
Wir Volkskundler sind Generalisten. Wenn zwei Volkskundler*innen zusammenkommen, steht oft die Frage im Raum: Was genau ist Volkskunde? Volkskundler*innen haben einen breiten Horizont und können sich schnell auf neue Themen einlassen. Als Laienrichter am Strafgericht musste ich z.B. gerichtsmedizinische Gutachten studieren und mich in die Fälle einarbeiten. Richtig nahe an der «Volksseele» war ich dann aber im Zivilgericht und später in der Politik – da erlebt man die ganze Spannweite der Gesellschaft und deren Kultur, von den schönen Seiten bis in die tiefsten Niederungen. Das Studium der Volkskunde hat mir da sicher geholfen, die Menschen und ihre alltäglichen Bedürfnisse besser zu verstehen.
Das Interview führte Sibylle Meier
Patricia Jäggi: Der Klang der Stille

Patricia Jäggi (*1980) ist in Davos aufgewachsen. Sie studierte Kulturanalyse, Germanistik, Kunstgeschichte sowie Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft in Zürich und Bern; 2017 schloss sie an der Universität Basel ihr Doktorat in Kulturanthropologie ab. Seit 2012 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Luzern, Musik. Sie interessiert sich besonders für Alltagsklänge, Ökologie und Sound Art. Sie ist mit Langlaufski oder Wanderschuhen im Engadin anzutreffen und fordert gerne ihre Ohren an Konzerten mit experimenteller Musik heraus. Möglichst oft spaziert sie durch den Wald und umarmt Bäume.
Porträtbild © Andri Pol
Während ich das schreibe, sitze ich im Quarantänehotel in Reykjavík. Es ist still hier. Wenn das Fenster geschlossen ist, hört man die vierspurige Strasse nur ganz leise. Der Wind und die Sonne lassen manchmal die Metallpaneele, die an der Fassade aussen angebracht sind, leise metallisch knacken. Wenn ich das automatische Klappfenster öffne, höre ich manchmal die Möwen im Flug lachen. Jetzt gehen Türen rhythmisch auf und zu. Eine Frau mit Mund-Nasen-Schutz, Schutzbrille, Haarnetz, Plastikanzug und -handschuhen geht mit einem Wagen durch den Flur und bringt allen Hotelgästen das Mittagessen, verpackt in Einweggeschirr. Manchmal quietschen die Räder des
Wagens etwas, sonst hört man nur ihr Klopfen und die Türen.
Während ich das schreibe, kommt es mir selber ganz friedlich und nett vor. Doch fühlt es sich nicht als eine neutrale, auch nicht als eine wirklich angenehme Stille an. Es ist aber auch keine unheimliche Stille, wie sie sie Menschen im ersten Lockdown erlebt haben. Ich erinnere mich an die beschriebenen Wahrnehmungen von Stille, und welche Ängste und Hoffnungen diese in den Menschen ausgelöst hat. Dennoch habe ich für die hier erlebte Corona-Stille keinen Begriff finden können. Die Stille hier scheint mir dennoch eine beschriftete Stille zu sein. Sie trägt ein Etikett, dessen verstörende Aufschrift man nur für sich lesen und behalten soll. Vor eineinhalb Jahren hätte ich nie damit gerechnet, dass ich mich einmal wie im Film «Outbreak» fühlen würde. Anstelle eines tödlichen Dschungeldorfs ist es hier ein Viersternehotel, das zur «Kontaminationszone» umfunktioniert wurde und sich im Vergleich zu «Outbreak» mit seiner ganzen zwischenmenschlichen Dramatik völlig verschlafen anfühlt. Isolation produziert Stille, nichts für Blockbuster. Die Action meines ganz eigenen Films wird jeweils vom Klingeln des Hoteltelefons eingeleitet. Denn sobald es für meinen einstündigen Spaziergang eine Möglichkeit gibt, ruft die Rezeption an. Dafür setze ich mich täglich auf die Warteliste. Wenn es soweit ist, holt mich jemand des Rotkreuz-Teams ab, natürlich in Vollmontur, um mich zum Lift zu begleiten und den Knopf ins Foyer zu drücken. Ich darf ausserhalb des Zimmers nichts anfassen. Aus dem Fenster vor dem Lift im 11. Stock sieht man bis zum Fagradalsfjall. Ich frage die Person jeweils, wie sich dieser erst kürzlich ausgebrochene Vulkan derzeit verhalte; eine eher banale Frage, nur, um diese sonderbare zwischenmenschliche Situation mit etwas ganz Alltäglichem aufzulockern. Obwohl so ein Vulkan für mich eigentlich keinesfalls alltäglich, sondern völlig aussergewöhnlich ist.
Klänge sind physikalisch gesehen Schall, sind Wellen in einem elastischen Medium, wie die Luft es ist. Klänge sind aber für mich besonders als kulturelle Objekte interessant, wie sie der phänomenologische Philosoph Maurice Mer-
leau-Ponty beschrieben hat. Unsere Sinnes-
tore funktionieren nach Merleau-Ponty nicht neutral, sie sind wie Filter, oder man könnte sie auch Interfaces/Schnittstellen nennen, durch die die Schallwellen, die auf das Ohr treffen, am Ende als ein kulturelles Objekt, als etwas Gehört-Gefühlt-Interpretiertes rauskommen. Als Kulturanthropologin, die an einer Musikhochschule forschen darf, interessieren mich das Hören und die Zusammenhänge, die Verortungen und Beziehungen, die es schafft. Ein Beispiel dafür sind die unterschiedlichen Empfindungen und Wertungen von Stille und Lärm.
Was mich als transdisziplinäre Forscherin am Vielnamenfach Volkskunde besonders fasziniert, ist letztlich seine thematische Diversität. Mir ist kein anderes Fach begegnet, das eine solche Themenvielfalt und -breite vorweisen kann. Diese Offenheit ist es auch, die mich an die SGV und ihr Engagement bindet. Ich könnte diese Haltung mit einem globalen Hören vergleichen, wie es die Musikerin Pauline Oliveros praktiziert und angeleitet hat. Bei einem globalen Hören geht es darum, allen Klängen, den nahen, fernen, den lauten und leisen, auch denen, die gleichzeitig im Zeit- und Raumkontinuum auftreten, Aufmerksamkeit zu schenken. Doch dieses globale Hören braucht dazu ein fokussiertes Hören, bei dem ein spezifischer Klang oder eine Abfolge von Klängen verfolgt wird. Es ist dieses Oszillieren zwischen globaler auditiver Offenheit und einem Fokussieren auf etwas spezifisch Klingendes, was nach Oliveros ein tieferes Verständnis für die Klangumwelt ermöglichen kann. Eine solche Kultivierung einer geistigen Weite und Tiefe, die das Lokale, Kleinräumige und Einzelne dabei im Blick respektive auch im Ohr behält, wünsche ich mir auch für die nächsten 125 Jahre zu schreibender SGV- Geschichte.
Hans-Ulrich Vollenweider: Wir haben ganz bewusst den Kontakt zu den Einheimischen gesucht

Hans-Ulrich Vollenweider (*1946) ist 1999 als Kassier in den Vorstand gewählt worden. 2006 hat er zusätzlich das Ressort Reisen übernommen. Er war Filialleiter bei der Zürcher Kantonalbank und übte auf kommunaler Ebene verschiedene politische Ämter aus, unter anderem als Gemeinderat und Gemeindepräsident von Marthalen/ZH. Seit der Pensionierung engagiert er sich vermehrt für den Zürcher Heimatschutz (Präsident der Stiftung) und in einer Stiftung für Menschen mit Beeinträchtigung. Er übt sich gern in Handwerklichem wie Schreinern, Drechseln oder Mähen mit der Sense.
Porträtbild © Andri Pol
Herr Vollenweider, was bringt einen Banker dazu, der SGV beizutreten?
Hans-Ulrich Vollenweider: Als Bankfachmann ist man sehr nah am Leben der Menschen, es geht immer ums Existenzielle, ums Persönliche. Eines Tages blätterte ich im damaligen Korrespondenzblatt der SGV und stiess dabei auf einen Artikel über die Bedeutung der Störmetzger für den bäuerlichen Alltag. Das hat mich fasziniert, und deshalb bin ich der Sektion Zürich beigetreten. Als Banker war ich immer im Kundenkontakt, der Lebensalltag hat mich immer interessiert. Deshalb war die alltägliche Lebenswelt auch meine Berufswelt.
Wo sehen Sie beim Geld und beim Handel die volkskundliche Perspektive?
Geld ist eine existenzielle Lebensgrundlage. Und die SGV hat sich immer wieder diesen alltäglichen Themen gewidmet. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Serie von Filmen im Jahr 1999, in denen junge Forscher festhielten, welche Gruppierungen sich beim Zürcher Hauptbahnhof herumtreiben oder wie es einem alten Menschen ergeht, der noch einmal den Wohnort wechseln muss. Solche Lebensrealitäten brachten eine interessante und lehrreiche Erweiterung meines beruflich stark auf die Finanzen gerichteten Blicks.
Die Reisen der SGV entstanden ursprünglich aus Studentenexkursionen, deren Erfahrungen und Kontakte man für volkskundliche Mitgliederreisen verwerten wollte. Der damalige Volkskundeprofessor an der Universität Zürich und SGV-Reiseleiter Paul Hugger (1930–2016) gab unter anderem die Reihe «Das volkskundliche Taschenbuch» heraus, welche auf Lebensgeschichten und Tagebüchern beruhte, die er auf Flohmärkten fand.
Als SGV-Vorstandsmitglied haben Sie das Ressort Reisen erfolgreich ausgebaut. Was fasziniert Sie am Thema Reisen?
Auf Reisen lernt man, Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Meine erste SGV-Reise als Teilnehmer führte nach Mecklenburg-Vorpommern. Paul Hugger hat das Tagebuch einer Aargauer Bankiersgattin in seiner Reihe herausgebracht. Sie beschreibt die Ferienreise über Berlin nach Heringsdorf und die aufkommende Badekultur um 1900 an der Ostsee, aber auch vom kaiserlichen Pomp in Berlin war sie sehr angetan. Hugger hat uns auf der Reise an einige dieser Badeorte geführt und in Heringsdorf die Buchvernissage zu einem lokalen Anlass gemacht. Das hat mich fasziniert, und von da an sind meine Frau und ich jedes Jahr mitgegangen. 2006, kurz vor meiner Pensionierung, habe ich das Ressort übernommen und bis 2019 geführt.
Was zeichnet volkskundliches Reisen aus?
Wir haben immer ganz bewusst den Kontakt zu den Einheimischen gesucht und haben stets mit lokalen Volkskundlern zusammengearbeitet. Ich erinnere mich beispielsweise an ein Frühstück in der Ukraine, das wir mit Schülerinnen und Schülern einer privaten deutschen Sprachschule einnehmen durften. Ich sass am Tisch mit einer ausgebildeten Gynäkologin, die zwar im Spital arbeitete, aber noch bei ihren Eltern wohnte. Mit einem Salär von 300 Euro könne sie sich keine eigene Wohnung leisten, erzählte sie mir. Deswegen lerne sie Deutsch, denn sie habe bereits ein Angebot eines deutschen Regionalspitals, das ihr die Reise zum Vorstellungsgespräch bezahlen wolle. Solche Geschichten erlebt man nur, wenn man Zeit hat, sich auf die Menschen und ihren Lebensalltag einzulassen.
Das Interview führte Sibylle Meier
Nicole Peduzzi: Meine Lieblingsfotografie? Die Postkarte!

Nicole Peduzzi (*1976) ist im italienischsprachigen Cama (GR) aufgewachsen. Nach der Matura in Chur hat sie in Basel Ethnologie, Geschichte und vergleichende Religionswissenschaft studiert. Ihr Interesse für historische Fotografie aus dem Pazifik führte sie nach Norwich (GB). Dort verfasste sie eine Dissertation über den australischen Fotografen und Postenkartenproduzenten Charles Henry Kerry (1857–1928). Sie arbeitete im Museum der Kulturen in Basel, im Fotoarchiv der Basler Mission und im Metropolitan Museum of Art in New York. 2014 übernahm sie die Koordination des SGV-Fotoprojektes. Aktuell arbeitet sie als Leiterin des Fotoarchivs sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am SNF-Sinergia-Projekt «Partizipative Wissenspraktiken in analogen und digitalen Bildarchiven». So oft wie möglich besucht sie das Misox und geht gerne mit ihrer Familie in den Bergen wandern.
Porträtbild © Andri Pol
Oft werde ich nach meiner Lieblingsfotografie im SGV-Archiv gefragt. Meine Antwort? Ich habe keine Lieblingsfotografie. Aber natürlich nicht, weil mir keine der Fotografien gefällt. Ganz im Gegenteil. Jede SGV-Fotosammlung enthält Fotografien, die in Bezug auf ihre physische Beschaffenheit, ihren Bildinhalt, ihren Entstehungszusammenhang, ihre Verwendungszwecke sowie die Intentionen der Person, die sie produziert hat, bemerkenswerte, verblüffende und einmalige Aspekte in sich bergen.
Gewiss, viele Fotografien besitzen eine «intuitive» Ästhetik. Aber was ist es, das eine Fotografie für einen Menschen interessant macht? Fotografien haben neben ihrem Bildinhalt unterschiedliche und adaptive materielle Präsentationsformen. Das gerahmte Bild der Familie auf dem Schreibtisch; das Passfoto der Freunde im Portemonnaie; das Bild der Enkelkinder als Hintergrund auf dem Smartphone; das gebundene Album des letzten Urlaubs; das Hochzeitsfoto als Panorama über dem Ehebett; die Gedenkfotos an die Verstorbenen auf dem Hausaltar.
Die Fotografie ist ein gesellschaftlich bedeutungsgeladenes Objekt, das im Leben vieler Menschen eine wichtige – bewusste oder unbewusste – Rolle spielt. Die Vielschichtigkeit, Vielfältigkeit und Vielseitigkeit der Fotografie öffnet den Raum für persönliche sowie gemeinschaftlich geteilte Zugänge, Perspektiven und Emotionen. Menschen betten Fotografien in Sinnzusammenhänge ein und schreiben ihnen einen materiellen und symbolischen Wert zu.
Zwar habe ich keine Lieblingsfotografie. Aber es gibt eine Art von Fotoobjekt, die mich in meinem beruflichen Werdegang stark geprägt hat: die Postkarte. Dieses facettenreiche, alltägliche und manchmal zu Unrecht banalisierte Fotoobjekt ist im SGV-Archiv mit zahlreichen Exemplaren vertreten. Die Postkarte hat mich zu mehreren Forschungsreisen veranlasst – und mich schliesslich im Jahr 2014 zur SGV wieder nach Basel geführt.
Nach meinem Studium der Ethnologie und Geschichte in Basel konnte ich mein Interesse für visuelle Anthropologie in den USA am Metropolitan Museum of Art vertiefen, wo ich während eines Jahres intensiv an einer Sammlung von historischen Postkarten aus dem pazifischen Raum arbeitete. Dabei habe ich die Grundlagen für mein Dissertationsprojekt über den australischen Fotografen und Postkartenhersteller Charles Henry Kerry (1857–1928) an der University of East Anglia gelegt. Trotz des grossen Potenzials der Postkarten als Quellen für die kulturhistorische Forschung wurden sie bis vor wenigen Jahren in den Darstellungen der Fotogeschichte weitgehend ignoriert und in manchen Fotoarchiven gegenüber den «echten Fotografien» als zweitklassige Objekte behandelt.
Werden die verschiedenen Herstellungsprozesse von Postkarten genauer betrachtet, wird aber klar, dass auch Postkarten «echte Fotografien» sein können – im Sinne einer chemischen Entwicklung direkt auf einem Träger mit Postkartenlayout. Wir sprechen von sogenannten «Real Photo Postcards» (RPPC), die von den gedruckten fotomechanisch massenproduzierten Postkarten unterschieden werden. Die RPPC zeigen Schnappschüsse von alltäglichen Situationen und ermöglichen so intime Einblicke in das Leben der Menschen; Einblicke, die zum Teilen mit anderen ausgewählt wurden. Doch gerade diese RPPC werden oftmals nicht als Postkarte erkannt, wenn sie etwa in einem Album eingeklebt sind und die Rückseite nicht sichtbar ist. Somit werden auch die eigentliche Funktion des Objekts und die damit verbundene Intention der ursprünglichen Besitzer*in nicht erkannt.
Postkarten waren und sind nicht nur ein weitverbreitetes Kommunikationsmittel. Sie tragen auf sich Spuren menschlichen Handelns und Denkens sowie zwischenmenschlicher Interaktionen. Jede Postkarte schreibt so ihre eigene Biografie, die nur durch akribische Untersuchungen am Objekt gelesen werden kann. Nicht selten werden Postkarten zum Schlüsselobjekt, um Sinnzusammenhänge innerhalb einer Fotosammlung erschliessen zu können.
Postkarten und Fotoobjekte im Allgemeinen sind aber nicht nur passive Zeugen menschlicher Interaktionen. Sie selbst geben Anlass für Begegnungen – und das bis heute. So ist auch das SGV-Fotoarchiv nicht als statisches Endlager verstaubter Fotoobjekte zu verstehen, sondern als ein sich ständig verändernder Ort, wo Menschen aus verschiedenen Generationen, unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen zusammenkommen und sich über die Fotoobjekte austauschen. Das Fotoarchiv ist ein dynamischer Begegnungsort zur Wissensgenerierung und Wissensdokumentation.
Ich bin sehr dankbar, dass ich in den letzten Jahren im Rahmen des Fotoprojektes an den vielfältigen Begegnungen, Kollaborationen und Transformationen im SGV-Fotoarchiv, welche die Grundlagen für weitergehende Forschungsprojekte geschaffen haben, teilhaben durfte. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das analoge und digitale SGV-Archiv seine anregende und partizipative Dynamik weiterentwickelt und für viele Menschen ein attraktiver Ort der Begegnung und des Wissensaustauschs ist.
Tamara Ackermann: Von der Musik und den Menschen

Tamara Ackermann (*1990) schloss ihren Master an den Universitäten Basel und Bern in den Fächern Musikwissenschaft und Editionsphilologie im Jahr 2019 ab. Nach dem Studium arbeitete sie kurzzeitig im Staatsarchiv Basel-Landschaft. Ein zweites Masterstudium in Digital Humanities und Kulturanthropologie hat sie 2021 abgebrochen, um ein Doktorat in Musikwissenschaft zu beginnen. Darin möchte sie die Repertoireentwicklung innerhalb der schweizerischen Blasmusikszene seit dem ersten eidgenössischen Musikfest in den 1880er-Jahren untersuchen. Wenn sie nicht gerade Saxophon spielt, beschäftigt sie sich mit Handarbeiten oder schaut sich Science-Fiction-Filme an.
Porträtbild © Andri Pol
Langsam schliesse ich den Koffer, während mein Blick auf den Schreibtisch fällt. Darauf stapeln sich Bücher zur Geschichte der schweizerischen Blasmusikszene. Vor knapp einem Jahr habe ich mich dazu entschlossen, eine Dissertation zu diesem Thema zu schreiben. Eine Entscheidung, die nur folgerichtig war, denn ich schloss mein Masterstudium der Musikwissenschaft ebenfalls mit einer Arbeit über das musikalische Repertoire von Amateur:innen ab. Damals war es der Schweizerische Arbeitersänger-Verband, heute ist es nun die Blasmusik.
Es war unter anderem die SGV, die mich auf dieses Forschungsgebiet brachte. Im Jahr 2015 habe ich meine Tätigkeit für das Volksliedarchiv in Basel aufgenommen, welches ich dann ab 2017 leitete. Volkslieder haben in der Regel keine anspruchsvollen Melodien und Harmonien, die es zu analysieren gilt. Die Texte sind meist keine poetischen Meisterwerke, aber sie erzählen von den Menschen, die sie geschrieben, gesungen und überliefert haben. Es ist dieser Umstand, der mein Interesse für die Musik von Amateur:innen weckte. Ich denke, dass sich die Gesellschaft in keiner anderen kulturellen Tätigkeit so sehr spiegelt wie in der Musik, die sie spielt und hört. Dies wurde mir in besonderem Masse durch meine Arbeit im Volksliedarchiv vor Augen geführt. Ein Grossteil der Liedblätter stammt aus Einsendungen aus der Bevölkerung an die SGV. Damals – zu Beginn des 20. Jahrhunderts – konnte kaum jemand Noten schreiben, weswegen diese auf den Blättern oft fehlen. Doch schon die Hingabe, mit welcher die Texte niedergeschrieben wurden, zeigt, wie viel sie den Menschen bedeutet haben mussten.
Neben der Faszination für die musikalischen Handlungen der Amateur:innen haben mich verschiedene Projekte innerhalb des Archivs auch mit den Methoden der Digital Humanities vertraut gemacht. Die digitale Archivierung von Archivbeständen und deren entsprechende Aufbereitung ist ein spannendes Feld, das allerdings auch etwas Einarbeitungszeit erfordert. Aus diesem Grund habe ich verschiedene universitäre Kurse in den Digital Humanities besucht und für dieses Fach eine gewisse Leidenschaft entwickelt. Da man mit diesen Methoden viel grössere Datenmengen analysieren kann als ohne, eröffnen sich ganz neue Forschungsfragen, die es zu beantworten gilt. Aus diesem Grund werden sie auch in meinem Doktoratsprojekt zur Anwendung kommen.
Dies sind nur zwei Punkte, die zeigen, wie meine Tätigkeit beim Volksliedarchiv, die im Jahr 2020 endete, meinen Werdegang als Musikwissenschaftlerin prägte. Wahrscheinlich würde ich mich heute mit anderen Fragestellungen beschäftigen, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, mich mit der Volksliedsammlung und allem, was damit verbunden ist, auseinanderzusetzen.
Mein Blick löst sich wieder von meinen Büchern. Ich schwinge meinen Saxophonkoffer auf den Rücken und mache mich auf den Weg zu meiner Blasorchesterprobe.
Hans-Ulrich Schlumpf: Der Abteilungsleiter Film, das fremde Wesen

Hans-Ulrich Schlumpf (*1939) ist in Zürich geboren. 1962 begann er ein Studium der Kunst- und Literaturgeschichte an der Universität Zürich, das er mit einer Dissertation über Paul Klee abschloss. Seit 1974 ist er selbstständiger Filmautor und von 1980 bis 2015 war er Leiter der Abteilung Film der SGV. Er hat viele Filmprojekte realisiert, etwa den Film «Der Kongress der Pinguine» (1993). Seine Freizeit verbringt er gerne mit Schreiben und Fotografieren. www.Film-Schlumpf.ch
Porträtbild © Andri Pol
Den Volkskunde-Professor Paul Hugger lernte ich in Zusammenhang mit der Recherche zu meinem Film «Hobby» (veröffentlicht 1978 als «Kleine Freiheit») kennen. Ich erhoffte mir von ihm nähere Auskünfte und Tipps für die geplante Sequenz über die Schrebergärten, von welchen mein Film handelte. Das war wenig ergiebig, aber wir verstanden uns auf Anhieb gut, und er lud mich ein, an einer Serie «Wir und...» für das Schweizer Fernsehen teilzunehmen, die er als Volkskundler mitbetreute. So bin ich zwar mit meinem eigenen Projekt nicht vorangekommen, hatte aber unerwarteterweise ein neues, das im Jahr 1977 als «Die Bühne im Dorf, das Dorf auf der Bühne» Premiere hatte.
Paul Hugger war eine aussergewöhnliche Persönlichkeit, aber wegen seines altmodischen, oft unnahbaren Wesens bei manchen Studierenden und Kollegen wenig beliebt. Dagegen war das Ansehen Huggers in der Westschweiz gross, wo zum Beispiel der Verleger Bertil Galland unter dem Titel «L’éthnologue» einen begeisterten Artikel über ihn in «Le Temps» veröffentlichte. Auch Yves Yersin, welcher später den Welterfolg «Les petites fugues» (1979) drehen sollte, zollte ihm in einem Interview über seine Filmarbeit für die SGV mit Thomas Schärer noch 2008 höchste Anerkennung.
Als Hugger mich 1978 das erste Mal fragte, ob ich sein Nachfolger als Leiter der Abteilung Film der SGV werden wolle, lehnte ich dankend ab. Als er mich nach der kurzen Amtszeit von André Jeanneret, der bei einem Deltaflug 1980 ums Leben kam, erneut fragte, sagte ich unter der Bedingung zu, dass meine Arbeit entschädigt würde. Dieses Ansinnen war in diesem Verein ungewöhnlich (im Vorstand waren ja fast alle Professoren oder Mittelschullehrer mit guten Einkommen), aber Hugger setzte sich durch. Diese Symbiose, die mir ein bescheidenes Einkommen, der SGV ein Zugpferd in Sachen Film bescherte, hielt erstaunlicherweise bis zum Jahre 2015, und dies trotz ständigen Auseinandersetzungen mit den jeweiligen Präsidenten der SGV um eben diese Entschädigung und den tieferen Sinn meiner Tätigkeit.
Paul Hugger hatte mit der Zusammenarbeit mit jungen Schweizer Filmschaffenden ein Modell ersonnen, das der SGV Ruhm weit über die Grenzen des Fachs und des Landes hinaus einbrachte. Namen, die zum festen Bestand der jüngeren Schweizer Filmgeschichte gehören – wie Yves Yersin, Jacqueline Veuve, Claude Champion, Renato Berta, Friedrich Kappeler, Pio Corradi, Groupe de Tannen und ich selber – schufen moderne Dokumentarfilme mit ethnologischem Inhalt, die an internationalen Festivals gezeigt wurden. Diese Filme waren wegen ihrer oft sozialkritischen Ausrichtung dem einen oder anderen Vorstandsmitglied der SGV zwar ein Dorn im Auge, aber den Erfolg genossen sie dann doch. So kam es, dass ich im Vorstand, trotz meiner Kosten, immer wieder Unterstützung fand, insbesondere durch Paul Hugger, Ueli Gyr, Walter Leimgruber, Francis Hildbrand und – als grosse Ausnahme – sogar von einem der Präsidenten der SGV, von Hans Schnyder.
Ich will hier nicht im Einzelnen aufzählen, was ich alles für die SGV getan habe. Gerne erinnere ich mich aber an die Filmarbeiten, wie etwa die Reihe «Technisiertes Handwerk im Zeitalter der Automation», aus dem zwei abendfüllende Dokumentarfilme hervorgingen, nämlich Friedrich Kappelers und Pio Corradis «Der schöne Augenblick» (1986) über Dorf- und Wanderfotografen, sowie mein «Umbruch» (1987) über die Digitalisierung einer Zeitungsdruckerei. Beide Filme wurden im Kino gezeigt und an internationale Festivals eingeladen, wo «Umbruch» mehrere Preise bekam. Auch die Produktion und Begleitung der beiden Film-Dissertationen von Lisa Röösli («Hinterrhein – Umbruch im Bergdorf»; 2005) und Marius Risi («Im Lauf der Zeiten»; 2006) im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes 48 zu «Landschaften und Lebensräumen der Alpen», betreut von Walter Leimgruber und mir, machten Freude. Es waren die ersten Dissertationen in der Schweiz, die als Film angenommen wurden. Und Lisa Rööslis Film machte eine schöne Karriere im Schweizer Fernsehen und im Sender 3sat.
Wahr ist, dass das Arrangement mit der SGV, welches Paul Hugger eingefädelt hatte, mir viel gebracht hat. Es ermöglichte mir als Freischaffendem regelmässige Einnahmen, es ermöglichte mir tiefe Einblicke in die ethnographische Methode beim Filmen, und es brachte mir den Lehrauftrag ein, den ich ab 1982 an der Universität Zürich (als Gast auch in Basel, Hamburg und Innsbruck) hatte, wo ich viele Jahrgänge von VolkskundlerInnen und EthnologInnen in die Theorie und Praxis des ethnographischen Films einführte. 1999 begannen Ueli Gyr, Walter Leimgruber und ich mit der systematischen Produktion von studentischen Videofilmen zu ethnologischen Themen. Es war der Versuch, die WissenschaftlerInnen selbst dazu zu bringen, ihre Arbeit aufzuzeichnen und zu Filmen zu gestalten.
Das führt mich zurück zu den Wurzeln meines ethnologischen Interesses. Ich wurde in meiner Kindheit geprägt durch die unkorrekte Exotik fremder Völker, wie sie in den FippFopp-Filmclubs, in Wochenschauen oder in Hagenbecks Bilderalben gezeigt wurde. Ernsthafter und prägender war dann 1970 die Lektüre der «Traurigen Tropen» (1955) des grossen Ethnologen Claude Lévi-Strauss. In diesem Buch ist eigentlich alles enthalten, was Ethnologie und Ethnographie ausmacht, jenseits von Strukturalismus und den vielen streng wissenschaftlichen Büchern, die Lévi-Strauss auch geschrieben hat. So wurde ein Ethnologe aus Zürich zur Hauptfigur meines Spielfilmes «TransAtlantique» (1983), in dem dieser die Methode der teilnehmenden Beobachtung an den Passagieren eines Linienschiffs von Genua nach Rio de Janeiro ausprobiert.
Im Rückblick gesehen war ich also ein ziemlich fremder Vogel inmitten der VolkskundlerInnen der 80er- und 90er-Jahre, die sich noch gerne mit materieller Kultur, Handwerk und Ritualen beschäftigten, während draussen bereits die digitale Revolution anrollte.
Ruth Grunt: Es gibt für mich keine Fragen, denen ich nichts abgewinnen kann

Ruth Grunt (*1942) in Basel geboren, war Übersetzerin, Texterin, Beraterin, Erwachsenenbildnerin und Erzählerin und führte bis zu ihrer Pensionierung eine Kommunikationsagentur. Auf dem zweiten Bildungsweg studierte sie Linguistik, Ethnologie und Kulturanthropologie mit Schwerpunkt Kommunikation und Medien. Gegenwärtig ist sie im Forschungsprojekt «Oral History – Chemie und Stadtkultur» des Vereins Industrie- und Migrationskultur der Region Basel (www.imgrb.ch) aktiv. Es untersucht die Geschichte der Chemie- und Pharmaindustrie zwischen 1950 und 2000 und deren Einfluss auf die Alltagskultur von Stadt und Region Basel.
«Machen Sie das Fach zu Ihrem Violon d‘Ingres und bleiben Sie Mitglied der SGV», hatte mir Frau Professor Dr. Christine Burckhardt-Seebass geraten, als ich mich von ihr verabschiedete. Der Maler Ingres habe auch passioniert und sogar recht gut Violine gespielt. Für diesen Rat bin ich dankbar. An den Veranstaltungen der SGV treffe ich Menschen, die ähnliche Interessen und vertieftes Wissen haben und die mich auf neue Gedanken bringen. Höhepunkte sind Exkursionen, Gespräche oder Filmvorführungen. Es gibt für mich keine Fragen, denen ich nichts abgewinnen kann, dafür bin ich zu wissensdurstig.
Ich habe das, was manche Leute einen «ungeraden Lebenslauf» nennen. Erst mit 50 Jahren habe ich in Basel zu studieren begonnen, nachdem ich die Matura nachgeholt hatte. Meine beiden Kinder waren bereits erwachsen und meine kleine Kommunikationsagentur lief – dank Mitarbeit an grossen internationalen Projekten – ganz ordentlich. Im ersten Semester belegte ich Veranstaltungen in Wirtschaftsethnologie, Film und interkultureller Kommunikation. Im «Volkskundlichen Kränzchen» entdeckte ich, dass das Fach mehr bietet als Brauchtum und vergessenes Handwerk. Volkskunde wurde mein Haupt- und Lieblingsfach. Ab und zu habe ich sogar berufliches Wissen einbringen können, so z.B. bei einem Ausstellungsprojekt, das sich aus einem Seminar übers Tramfahren ergab. Neben der Erwerbsarbeit zu studieren, machte mir grosse Freude – bis sich mein Leben einmal mehr drehte und keine Zeit mehr für die Uni blieb.
Meine Agentur habe ich vor ein paar Jahren verkauft, ich beschäftige mich mit freier künstlerischer Arbeit. Als Mitglied des Vereins Industrie- und Migrationskultur der Region Basel wirke ich mit in einem Forschungsprojekt zum Einfluss von Chemie- und Pharmaindustrie auf die Alltagskultur der Region Basel. Wissenschaftlicher Leiter ist mein ehemaliger Studienkollege Dr. Nicholas Schaffner. Im Fokus stehen Personen, die zwischen 1950–2000 in unteren oder mittleren Positionen in der «Chemischen» tätig waren. Wir arbeiten mit der Methode der Oral History und u.a. mit Grounded Theory und möchten den Einfluss dieser Industrie auf Lebenswelt und Alltag in Stadt und Region zeigen. Nach wie vor faszinieren mich Menschen. Ich möchte wissen und lernen, was sie denken, glauben, was sie darüber sagen, wie sie es tun, was sie erschaffen, wie sie arbeiten und wohnen, was sie sich wünschen, wie und wovon sie leben und was ihnen lieb und wichtig ist. Ich bin also im Alter doch fast so etwas wie Kulturanthropologin geworden.
Aurelia Ehrensperger: Luft ist ein geteiltes Medium

Aurelia Ehrensperger (*1985) ist in Basel aufgewachsen. In Luzern hat sie Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften studiert und sich anschliessend an der Universität Zürich in die Kulturwissenschaften vertieft: Von 2014–2020 war Aurelia Ehrensperger wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin am Institut für Sozialanthropologie und empirische Kulturwissenschaften (ISEK). Im August 2020 hat sie ihre Dissertation über «Atmen in der Alltagskultur» abgeschlossen und widmet sich nun einem Kommunikationsprojekt an der Universität Zürich, welches jene Menschen ins Zentrum rückt, die ihr während ihrer wissenschaftlichen Laufbahn am meisten am Herzen lagen, die Studierenden.
Porträtbild © Andri Pol
Sie stellen den Körper ins Zentrum Ihrer Forschung. Welche Erkenntnisse ergeben sich daraus aus kulturwissenschaftlicher Perspektive?
Ich versuche, die Perspektive zu wechseln: Wie sich unsere Kultur auf den Körper auswirkt, interessiert mich weniger. Vielmehr untersuche ich, wie unser Körper auf die Kultur wirkt. Daraus ergeben sich spannende Fragen, beispielsweise: Wie verändern Körper ein Stück weit kulturelle Ansprüche und Anforderungen, die zwar geistig und gedanklich geformt sind, jedoch vom Körper limitiert werden? Das Atmen ist ein gutes Beispiel. Es ist selbsttätig und zeigt uns unsere körperliche Begrenzung auf. Wir können es nicht stoppen, auch wenn es zum Beispiel ein gefährliches Virus überträgt. Diese Zusammenhänge interessieren mich.
Corona greift unseren Körper direkt an, unsere Atemwege sind bedroht, Aerosole übertragen die Krankheit. Was passiert da gerade mit unserem Körperbild?
Ich denke schon, dass sich unser Körperbild durch Corona verändert. Luft ist ein geteiltes Medium – wir brauchen sie, um zu überleben. Die Pandemie führt uns vor Augen, wie sehr wir körperlich verbunden sind, global und im kleinsten Familienkreis. Das Bewusstsein für die Bedrohung dessen, was sprichwörtlich in der Luft liegt, ist durch Corona aktiviert worden. Wie die Menschen mit Tuberkulose umgegangen sind, ist nur wenigen im Gedächtnis geblieben. Dass man damals geschlossene Sanatorien geschaffen hatte, also Räume abgrenzte, um Ausbreitung zu stoppen, ist vielen von uns nicht mehr bewusst. Derzeit erleben wir eine ähnliche Situation: Die Mobilität wird eingeschränkt, die Grenzen werden geschlossen. Atmen ist elementar, und wir können uns dem nicht entziehen. Das Virus hat uns mit voller Wucht erwischt.
Ein weiteres Forschungsthema, mit dem Sie sich beschäftigen, sind Minimalismus und Masslosigkeit. Ist weniger mehr?
Ob weniger mehr ist, kommt auch immer darauf an, von welcher Perspektive aus man die Sache betrachtet. In der Ernährung gelten derzeit eher minimalistische Regeln, in Bezug auf Sport jedoch ist Masslosigkeit «in». Innerhalb einer Gesellschaft finden sich immer minimalistische und masslose Lebensweisen. Diese markieren die Ränder, entlang deren unsere Regeln sichtbar werden. Ein Beispiel: Fünf Biere zu trinken ist am Wochenende in Ordnung, unter der Woche aber nicht. Und es gibt gesellschaftlich akzeptierte Traditionen der Masslosigkeit, etwa die kollektive Masslosigkeit während der Fasnacht.
Unter normalen Umständen trifft man in einem Verein viele andere Menschen. Fühlen Sie sich wohl in einer «Ansammlung von Körpern»?
Ich habe mich in grossen Menschenmengen nie wohlgefühlt – ausser vielleicht als Teenager, da fand ich es spannend, die «Vibes» von anderen Körpern zu spüren. Hier hat meine Dissertation auch ein Stück weit meinen Blick geschärft: Mir ist bewusst geworden, wie viel Energie und Raum Körper verströmen und einnehmen. Damit muss man sorgfältig umgehen.
Das Interview führte Sibylle Meier